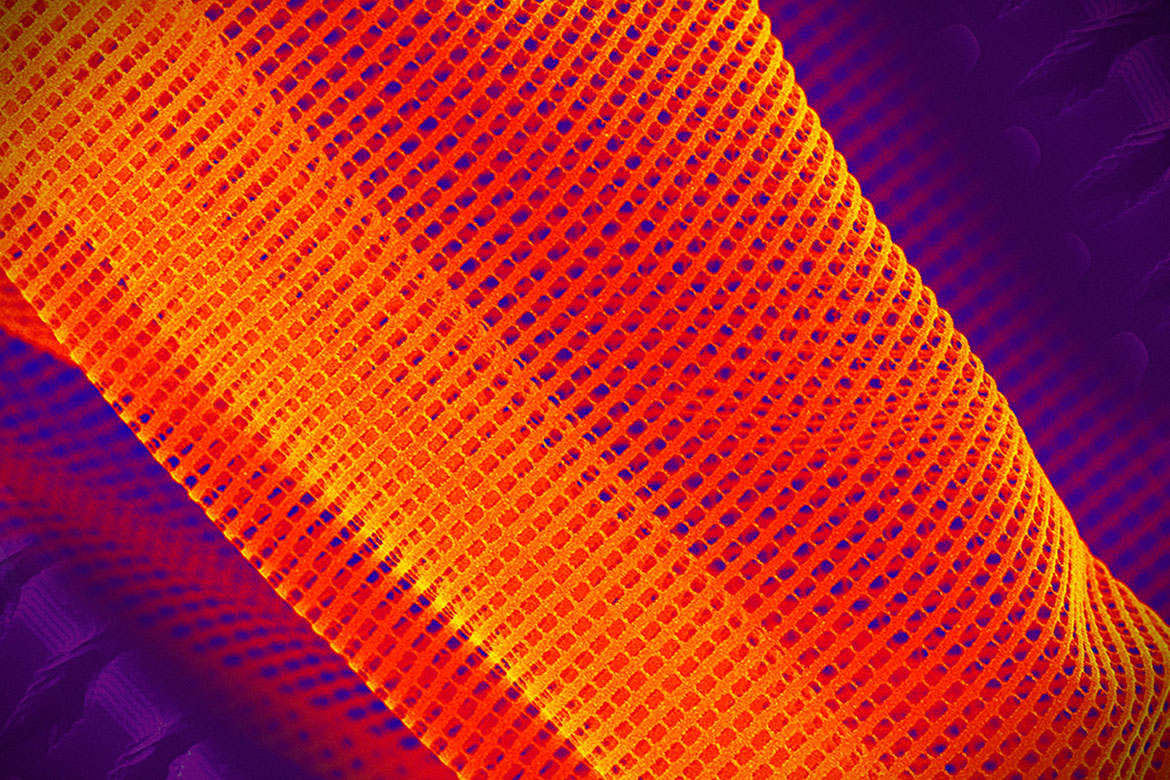Die transparenten Wissenschaftler
In den Laboren und im Feld entscheidet sich, wie künftig Wissenschaft betrieben wird. Vier Porträts stellen Forscher vor, die sich für eine offene Wissenschaft einsetzen – jeder auf seine Art.
 Malte Elson versteht unter Open Science die «maximale Transparenz beim wis sen schaft – lichen Arbeiten – und zwar in allen Belangen». Die Idee gebe es schon lang, meint der junge Psychologe mit Spezialgebiet Aggressivität und Computerspiele. Nun aber komme eine neue Generation, die «Zugänglichkeit zugänglich machen» möchte – und die sich um die Strukturen kümmert, damit Open Science kein leeres Versprechen bleibt. Elson versteht sich als Teil dieser neuen «nicht nur ideologischen, sondern technologischen» Bewegung. Er hat selbst zwei Webseiten lanciert: journalreviewer.org, eine Sammlung von Erfahrungsberichten über Reviewverfahren, und flexiblemeasures.com, wo auf akribische Weise Aggressionsmessun – gen von andern Forschenden unter die Lupe genommen werden – und die fehlende Standardisierung angeprangert wird.
Malte Elson versteht unter Open Science die «maximale Transparenz beim wis sen schaft – lichen Arbeiten – und zwar in allen Belangen». Die Idee gebe es schon lang, meint der junge Psychologe mit Spezialgebiet Aggressivität und Computerspiele. Nun aber komme eine neue Generation, die «Zugänglichkeit zugänglich machen» möchte – und die sich um die Strukturen kümmert, damit Open Science kein leeres Versprechen bleibt. Elson versteht sich als Teil dieser neuen «nicht nur ideologischen, sondern technologischen» Bewegung. Er hat selbst zwei Webseiten lanciert: journalreviewer.org, eine Sammlung von Erfahrungsberichten über Reviewverfahren, und flexiblemeasures.com, wo auf akribische Weise Aggressionsmessun – gen von andern Forschenden unter die Lupe genommen werden – und die fehlende Standardisierung angeprangert wird.
Elson nutzt vor allem das Open Science Framework, mit dem der Forschungsprozess vollständig dokumentiert werden kann, «von der ersten Idee bis zur Publikation». Das erhöhe die Transparenz des Vorgehens massiv, auch für den Forscher selbst: Er könne Jahre später noch genau nachvollziehen, was er gemacht habe: «Zudem schützt diese sehr reflektierte Art des Forschens auch davor, sich selbst zu täuschen.»
 Beim Open-Source-Malaria-Projekt ist das Internet gewissermassen Leitmotiv: der Netzwerkcharakter, der offene Fluss der Informationen und die Neuverhandlung von öffentlich gegenüber privat. «Wer auch immer am meisten Arbeit in das Projekt hineinsteckt, wird zum Leader, egal, wo auf der Welt er ist», sagt die Biochemikerin Alice Williamson, die die Initiative zur Entwicklung eines neuen Malaria-Wirkstoffs mit lanciert hat. Sie arbeitet in Sydney, beteiligt sind aber Forscher aus der ganzen Welt, darunter auch ein Software-Spezialist der EPFL.
Beim Open-Source-Malaria-Projekt ist das Internet gewissermassen Leitmotiv: der Netzwerkcharakter, der offene Fluss der Informationen und die Neuverhandlung von öffentlich gegenüber privat. «Wer auch immer am meisten Arbeit in das Projekt hineinsteckt, wird zum Leader, egal, wo auf der Welt er ist», sagt die Biochemikerin Alice Williamson, die die Initiative zur Entwicklung eines neuen Malaria-Wirkstoffs mit lanciert hat. Sie arbeitet in Sydney, beteiligt sind aber Forscher aus der ganzen Welt, darunter auch ein Software-Spezialist der EPFL.
Alle Forschungsdaten werden unmittelbar offengelegt. Auch die Kommunikation zwischen den Forschern findet «möglichst wenig per E-Mail», sondern vorzugsweise auf Seiten wie Github oder über Twitter statt. So könne Forschung nicht nur transparenter, sondern auch effizienter werden, sagt Williamson. Es sei eine «furchtbare Vergeudung von Forschungsmitteln», wenn verschiedene Labors an denselben Substanzen forschten und alle in der gleichen Sackgasse landeten. Sie organisiert regelmässig Workshops zur Führung von offenen Laborjournalen und merkt da, dass es für den Nachwuchs ganz normal sei, Erfolge wie auch experimentelle Irrwege zu teilen – so wie sie es auch im Privatleben handhaben.
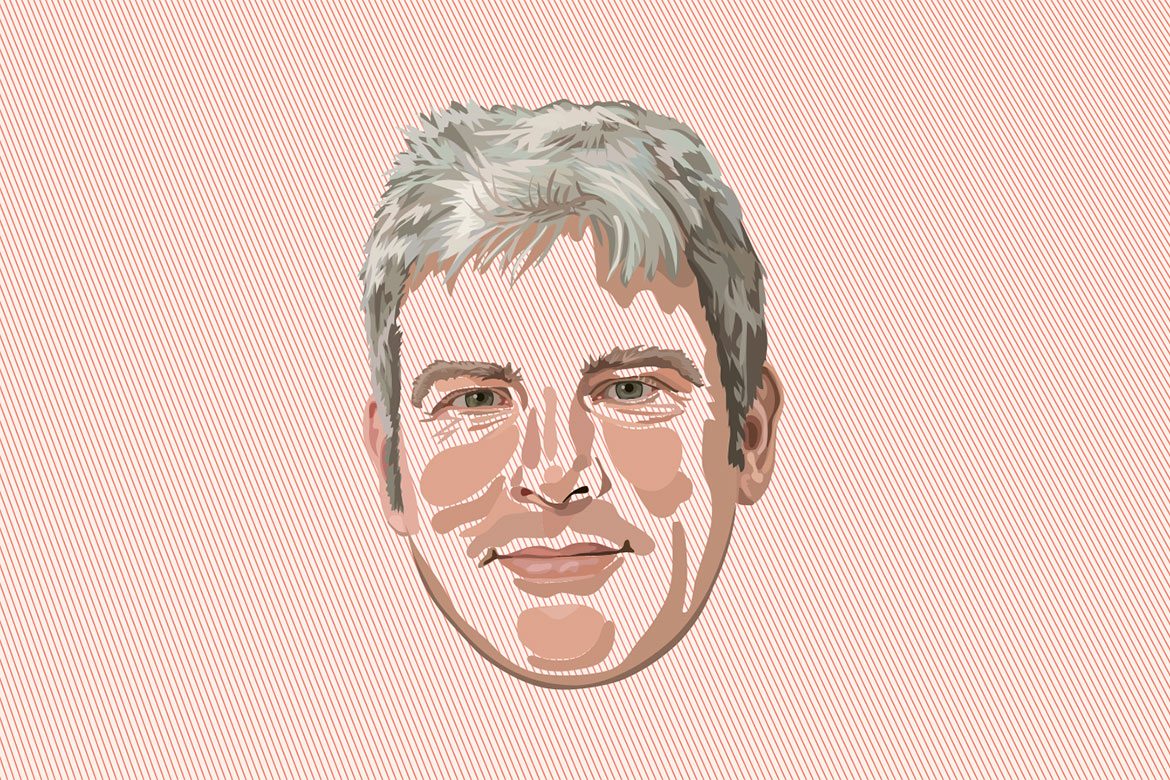 Die Deep-Learning-Community erprobt, via Online-Foren Forschungsansätze und -ideen zu diskutieren. Zunächst werden die Inhalte möglichst einfach zugänglich gemacht: «Die Tendenz geht dahin, alles auf dem Preprint-Server Arxiv zu veröffentlichen», sagt Oliver Dürr, Professor an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW). Der Programmiercode wird meist gleich mitveröffentlicht. Arxiv dient auch als Link quelle, um die sich allerlei weitere Diskussions foren scharen.
Die Deep-Learning-Community erprobt, via Online-Foren Forschungsansätze und -ideen zu diskutieren. Zunächst werden die Inhalte möglichst einfach zugänglich gemacht: «Die Tendenz geht dahin, alles auf dem Preprint-Server Arxiv zu veröffentlichen», sagt Oliver Dürr, Professor an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW). Der Programmiercode wird meist gleich mitveröffentlicht. Arxiv dient auch als Link quelle, um die sich allerlei weitere Diskussions foren scharen.
Sehr populär zum Beispiel ist laut Dürr Reddit, wo in spezialisierten Subforen Artikel verlinkt und kommentiert werden. Und im «Ask me anything»-Forum gibt es regelmässige Frage stunden, für die sich renommierte Kollegen zur Verfügung stellen: Peers reichen Fragen ein, die dann hoch- und runtergewertet werden können. Auch Blogs über Künstliche-Intelligenz-Forschung liest Dürr gern. Sein eigener diene mehr als Tagebuch, um seine Ideen festzuhalten. Manche, wie der von Andrej Karpathy, finden viel mehr Aufmerksamkeit: Die langen Einträge sind mit Reviews vergleichbar, und die Kommentarspalte ist voll mit Nachfragen und Anregungen. So bilden sich laufend neue Diskussionskreise, zu denen prinzipiell jeder Zugang hat – mit oder ohne universitären Abschluss.
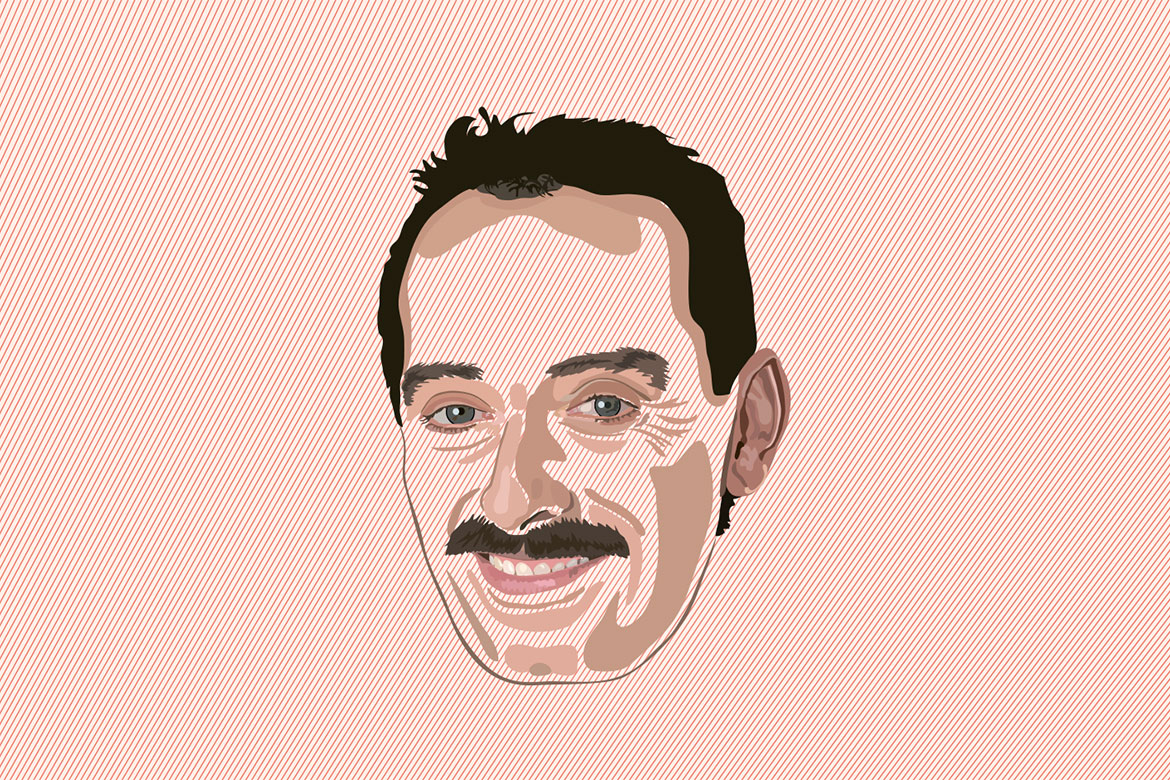 Der Roboterforscher Francesco Mondada von der EPFL baut sein Laborequipment selber, und für die Bauteile benutzt er am Computer CAD- Software (Computer Aided Design). Er möchte seine Baupläne der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen – das wäre selbstverständlich für ihn. Aber er bleibt im Kleingedruckten hängen: Für den Gebrauch von CAD-Software gibt es spezielle Lizenzen für Bildungs institutio nen, teure für die Industrie und verschiedene Dateiformate, je nach Lizenz. Und dazu ein Wirrwarr an Bestimmungen, denen man beim Kauf der Software zustimmt – und die kaum je die offene Verbreitung der Dateien vorsehen. Es ist ein wenig, als müsste ein Schriftsteller vor der Publikation Microsoft um Erlaubnis fragen, wenn er seinen Text mit Word geschrieben hat.
Der Roboterforscher Francesco Mondada von der EPFL baut sein Laborequipment selber, und für die Bauteile benutzt er am Computer CAD- Software (Computer Aided Design). Er möchte seine Baupläne der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen – das wäre selbstverständlich für ihn. Aber er bleibt im Kleingedruckten hängen: Für den Gebrauch von CAD-Software gibt es spezielle Lizenzen für Bildungs institutio nen, teure für die Industrie und verschiedene Dateiformate, je nach Lizenz. Und dazu ein Wirrwarr an Bestimmungen, denen man beim Kauf der Software zustimmt – und die kaum je die offene Verbreitung der Dateien vorsehen. Es ist ein wenig, als müsste ein Schriftsteller vor der Publikation Microsoft um Erlaubnis fragen, wenn er seinen Text mit Word geschrieben hat.
Mondada glaubt nicht, dass die Robotik diesbezüglich ein exotisches Feld ist: «Auch Biologen beginnen, 3D-Drucker in ihren Labors zu nutzen, die spezialisierte Software verlangen.» Seit Jahren kämpft er auch für einfachere Regelungen. Es gebe einen «Clash zwischen zwei Vorstellungen der Universität». Das alte Modell beurteile den Transfer in die Industrie von Fall zu Fall; das neue, offenere Modell stehe für einen offenen und unbürokratischen Austausch, nicht nur zwischen Akademikern, sondern auch mit der Industrie.