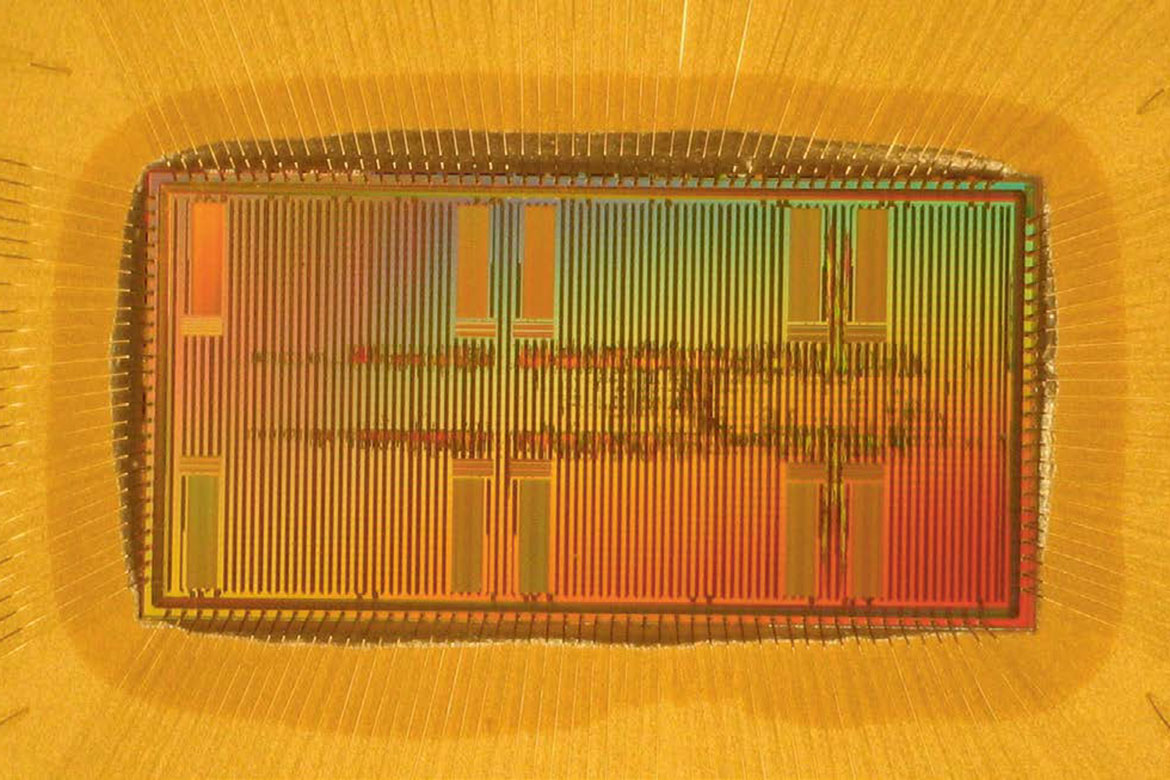Die Unschärfe am Ende
Der genaue Zeitpunkt des Todes lässt sich nicht eindeutig festlegen. Doch die Gesellschaft braucht ein klares Todeskriterium – zum Beispiel für Organspenden.
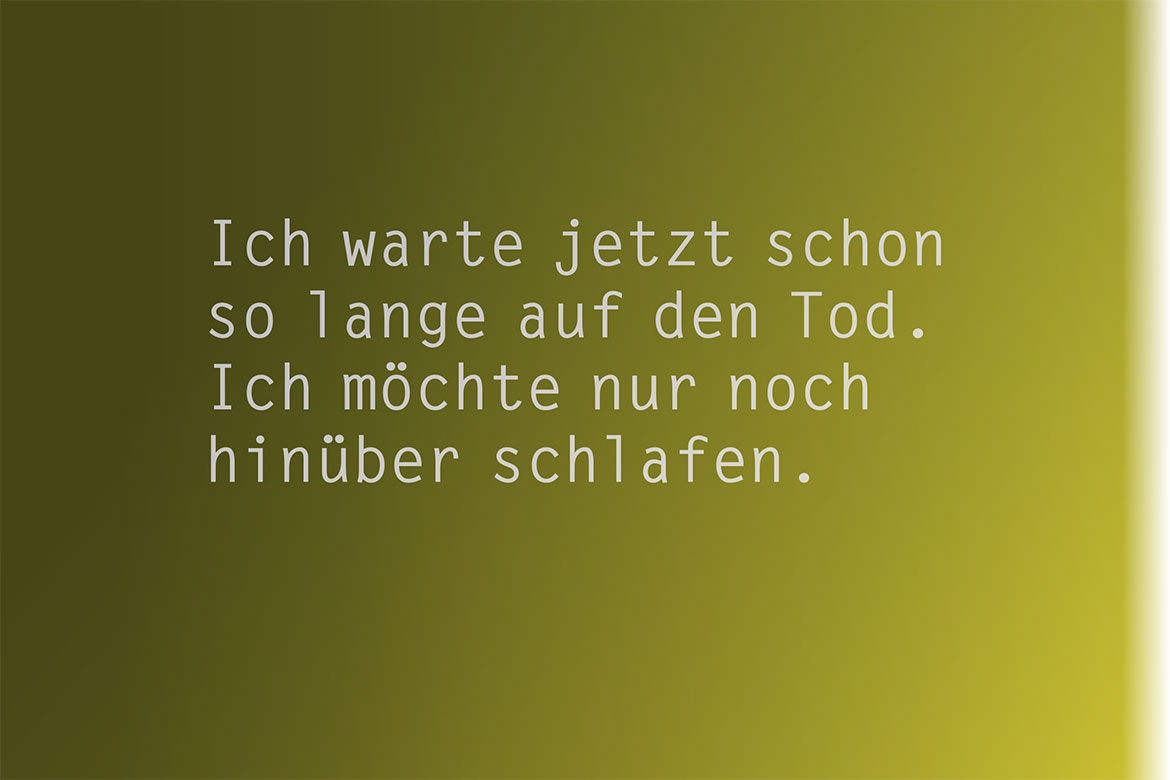
Patient, 77 Jahre, Lungenkarzinom, 11 Tage vor seinem Tod. Aus dem Forschungsprojekt «Sterbewünsche bei Menschen in schwerer Krankheit» der Palliativmedizinerin Heike Gudat.
Egal, ob wir früh bei einem Unfall ums Leben kommen oder ob wir ein biblisches Alter erreichen – irgendwann bleibt unser Herz endgültig stehen. Irgendwann hören wir auf zu atmen. Irgendwann funktioniert unser Gehirn nicht mehr.
«Es kann bis zu einer Woche gehen, bis die letzte Körperzelle abgestorben ist», erklärt Stephan Marsch. Auf die Frage, wann genau das Leben in den Tod übergeht, kann auch der Chefarzt der Medizinischen Intensivstation des Universitätsspitals Basel keine definitive Antwort geben. «Biologisch gesehen ist der Tod ein Prozess.» So kann zum Beispiel die Hornhaut der Augen noch drei Tage nach dem Tod erfolgreich transplantiert werden, und es ist bis zu einer Woche nach dem Tod noch möglich, dem Körper bestimmte Zellarten – wie etwa Knorpel – zu entnehmen und zu kultivieren.
Irreversibilität ist entscheidend
Doch legale und gesellschaftliche Anforderungen verlangen nach einer scharfen Grenze. «Wir können nicht sagen, die Person ist ein bisschen tot oder sie lebt noch ein bisschen», sagt Marsch. Nur lässt sich dieses binäre Ja/Nein nicht so einfach mit einem biologischen Prozess vereinbaren. Deshalb behelfen sich die Fachleute mit dem Kriterium der empirischen Irreversibilität. «Wenn ein Mensch gemäss gängiger Erfahrung nicht mehr ins Leben zurückkommen oder zurückgeholt werden kann, gilt er als tot.»
Die Meinung darüber, wann dieser Punkt erreicht ist, hat sich im Laufe der Medizingeschichte allerdings schon mehrfach geändert: Bis ins 19. Jahrhundert waren die Menschen auf ihre Beobachtungen angewiesen. Im Zweifelsfall wurde gewartet, bis nach einigen Stunden die Totenstarre einsetzte. Erst nach der Erfindung des Stethoskops erkannte die Medizin den Zusammenhang zwischen einem schlagenden Herzen und dem Leben. Obwohl – ganz sicher war man sich doch nicht. Medizinhistoriker berichten von teils rabiaten Methoden, mit denen Ärzte sicherstellten, dass ihre Patienten wirklich tot waren: Sie schoben ihnen Nadeln unter die Fussnägel und liessen heisses Wachs auf die Stirn tropfen. Dank besserer Stethoskope setzte sich der Herzstillstand aber bald als zuverlässiges Todeskriterium durch.
Der Hirntod löst den Herztod ab
Die rasante Entwicklung der Intensivmedizin in den 60er Jahren stellte jedoch die Gültigkeit des Herztods in Frage: Durch die neue Technik der künstlichen Beatmung konnten plötzlich Menschen am Leben gehalten werden, bei denen der Ausfall der Spontanatmung ansonsten zu einem raschen Herztod geführt hätte. Und bei einigen dieser Patienten war auch die Hirnfunktion vollständig erloschen. Waren diese Personen nun lebendig oder tot? Etwa zur gleichen Zeit feierte auch die Transplantationsmedizin ihre ersten Erfolge – und gerade diese künstlich beatmeten Patienten eigneten sich besonders als Organspender, da Herz, Nieren und Lunge noch voll funktionstüchtig waren. So wuchs der Druck, für diese Fälle ein neues, zuverlässiges Todeskriterium zu finden. Im Jahr 1968 schlug ein Komitee der amerikanischen Harvard Medical School erstmals den Hirntod dafür vor.
Der Hirntod ist in der Schweiz definiert als der irreversible Ausfall der Funktionen des Hirns einschliesslich des Hirnstamms. Der Hirnstamm gilt als der widerstandsfähigste Teil des Gehirns und ist der Sitz des Atemzentrums. Fällt der Hirnstamm aus, stoppt die Atmung, und das Herz erhält keinen Sauerstoff mehr. Ohne künstliche Beatmung kommt es unweigerlich zum Herzstillstand. Umgekehrt führt auch ein Herzstillstand in kürzester Zeit zum Hirntod: Wird das Gehirn nicht mehr durch den Blutkreislauf mit Sauerstoff versorgt, so ist nach etwa zehn Minuten keine Hirnaktivität mehr festzustellen.
Der gleiche Tod für alle
In der Schweiz wurde mit dem Inkraftsetzen des Transplantationsgesetzes im Jahr 2007 erstmals der Hirntod als einziges und für alle gültiges Todeskriterium festgelegt. Die Verordnung zum Gesetz verweist auf die Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW). Diese legen fest, welche klinischen Zeichen für einen Hirntod vorliegen müssen und wie dieser festzustellen ist: Dazu gehören unter anderem das Fehlen von bestimmten Reflexen, starre Pupillen und das Aussetzen der Atmung nach dem Abschalten der Beatmungsmaschine.
Der Chefarzt Transplantationsimmunologie und Nephrologie am Universitätsspital Basel, Jürg Steiger, hält Definition und Diagnose des Hirntods in der jetzigen Form für sicher und zuverlässig. Als Präsident der Zentralen Ethikkommission der SAMW und Leiter der Subkommission zur Revision der Richtlinien beschäftigt er sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema: «Die Kriterien sind seit 20 oder 30 Jahren unverändert geblieben. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass man etwas ändern muss.» Dennoch kann er gut verstehen, dass das Konzept des Hirntods für viele Menschen schwierig zu fassen ist: Tritt man an einen hirntoten Menschen heran, so sieht man, dass er atmet, wenn auch künstlich. Und er ist warm.
Ein Rest an Hirnaktivität
Zweifel an der Gültigkeit des Hirntods gibt es allerdings nicht nur aufgrund dieser äusserlichen Wahrnehmungen: Hirntote können auch noch viele Stoffwechselvorgänge selbständig aufrecht halten: Sie verdauen, regulieren ihren Hormonhaushalt und bekämpfen Infektionen. In einigen Fällen haben hirntote Frauen auch schon lebensfähige Kinder geboren. Kritiker des Hirntodkonzepts weisen zudem darauf hin, dass auch nach dem Ausfall des Stammhirns manchmal noch eine Restaktivität in einzelnen Zellen der Hirnrinde nachweisbar ist. Umstritten ist auch, ob ein Organspender möglicherweise noch Schmerz empfindet. Dass die Richtlinien der SAMW eine Anästhesie während der Organentnahme vorschreiben, hat damit jedoch nichts zu tun. Mit der Narkose sollen Reflexe unterdrückt werden, die über das noch intakte Rückenmark laufen.
Für Steiger bleibt das Gehirn das entscheidende Organ – auch aufgrund persönlicher Erfahrungen mit Sterbenden und Toten: «Das Herz ist nur eine Pumpe, die man notfalls durch ein mechanisches Gerät ersetzen kann. Für mich spielt sich das Leben im Kopf ab: Schmerz, Liebe und Hass." So kann trotz eines amputierten Beins ein Schmerz im Zeh verspürt werden – ein klares Zeichen, dass der Schmerz im Hirn und nicht im Rest des Körpers wahrgenommen wird. «Wenn das Hirn nicht mehr funktioniert, verschwindet auch ein zentraler Teil der Persönlichkeit.»
Das Todeskriterium selber wählen?
Über den Sitz der Persönlichkeit und ob diese mit dem Hirntod erlischt, wurde in der Schweiz bei der Einführung des Gesetzes allerdings wenig diskutiert. Ethische Diskussionen drehten sich hauptsächlich um Aspekte wie Einwilligung zur Organentnahme und gerechte Verteilung der gespendeten Organe. Der Rechtswissenschaftler Pascal Lachenmeier hat im Rahmen seiner Doktorarbeit an der Universität Basel die Festlegung des Todeskriteriums im Transplantationsgesetz genauer analysiert: «Die Einführung des Hirntodkonzepts hat in der Bevölkerung keine grossen Wellen geworfen. Die Menschen beschäftigen sich nicht gerne mit dem eigenen Tod und haben in diesem Fall darauf vertraut, dass die Naturwissenschaft eine sichere Methode liefert.» Er bedauert, dass das Todeskriterium vom Gesetzgeber als rein technischer Aspekt an eine Institution wie die SAMW delegiert wurde und keine grössere gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema stattgefunden hat.
Die Tatsache, dass das Hirntodkriterium mittlerweile in fast allen Ländern gilt, bedeutet jedoch nicht, dass es unumstösslich ist. So gab es etwa in den USA einzelne Vorschläge, schon den Verlust der kognitiven Fähigkeiten – also den Ausfall des Grosshirns – als ausreichendes Kriterium für den Tod zu betrachten. Lachenmeier hingegen schlägt ein grundsätzlich anderes Konzept vor. Und er stellt in Frage, ob eine Gesellschaft den Tod überhaupt allgemeingültig definieren kann und muss. Um die unterschiedlichen Auffassungen über den Todeszeitpunkt zu berücksichtigen, solle stattdessen jeder Mensch selbst entscheiden dürfen, wo für ihn persönlich die Grenze zwischen Leben und Tod liegt – sofern die Irreversibilität wie beim Hirnoder Herztod gewährleistet ist.
Yvonne Vahlensieck ist freie Wissenschaftsjournalistin in der Nähe von Basel.
«Liegt der Tod allerdings länger zurück, können wir nur noch grobe Schätzungen abgeben, je nachdem auf Wochen, Monate oder Jahre genau», erklärt Silke Grabherr, Direktorin des Centre universitaire romand de médecine légale, Lausanne/Genf. Wichtigster Anhaltspunkt ist dann der Fortschritt der Verwesung, die sich von der Darmflora aus über die Blutgefässe im Körper ausbreitet. Einen weiteren Hinweis gibt die Beschaffenheit einer wachsartigen Substanz, die sich bei sogenannten Wachsleichen unter Luftausschluss aus dem Körperfett bildet.
Die Analyse von Fliegen und Maden, die sich auf einer Leiche ansiedeln, hält Grabherr dagegen meist für unzuverlässig: «Man weiss zum Beispiel selten sicher, ob es sich dabei um die erste Generation der Insekten handelt.» Noch in der Entwicklungsphase sind Methoden, die den Todeszeitpunkt anhand der Konzentration von Stoffwechselprodukten in Körperflüssigkeiten bestimmen.