Kontroverse: Nützen Neurowissenschaften in der Psychiatrie?
Bildgebende Verfahren, die Genetik und Tierversuche: Wir wissen immer mehr über das menschliche Gehirn. Doch sind diese Erkenntnisse auch relevant für die Behandlung psychiatrischer Störungen?
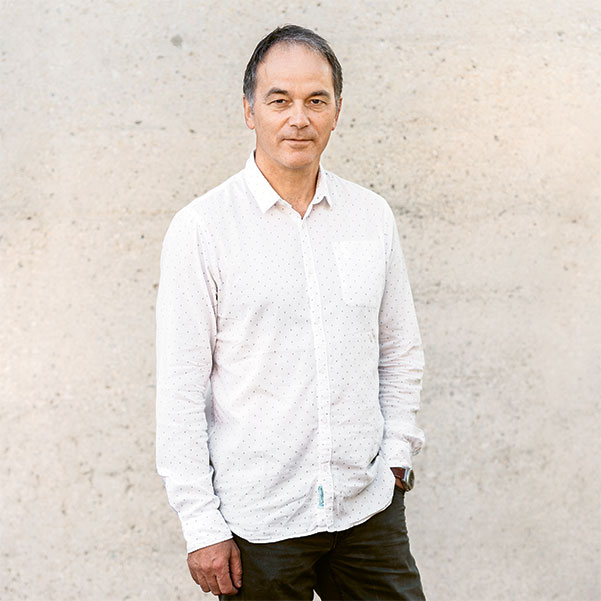
Bild: Valérie Chételat
Zweifellos liegen Welten zwischen den Psychiatrieanstalten der 1950er-Jahre und der modernen Psychiatrie. Dank der Entwicklung von Neuroleptika hat sich die Behandlung von Psychosen radikal verändert. Das Spektrum an psychotherapeutischen Methoden ist breiter geworden, und ihre Wirksamkeit ist nun wissenschaftlich belegt. Der Trend zur Deinstitutionalisierung hat dazu geführt, dass Behandlungen oft ambulant und mit einer anderen Haltung gegenüber den Betroffenen durchgeführt werden: Den Patienten kommt heute eine zentrale Rolle zu, wenn es darum geht, die Behandlung festzulegen.
Doch in den letzten vierzig Jahren beschränkte sich die Entwicklung auf die Optimierung bestehender Konzepte. Fortschritte stossen noch immer an dieselben Grenzen: Ungenau definierte Diagnosen mit demselben Etikett für Patienten mit offensichtlich verschiedenen Krankheiten, enorme Unterschiede beim Ansprechen auf Behandlungen und Wirkungslosigkeit bei zahlreichen Aspekten des klinischen Bildes, hohe Nebenwirkungsrate und fehlende Wirkung auf das Sozialleben.
Unser lückenhaftes Wissen über neurobiologische Mechanismen, die psychiatrischen Störungen zugrunde liegen, spielt dabei eine zentrale Rolle. Hier müssen die Neurowissenschaften dazu beitragen, die klinische Praxis zu verbessern. Erkenntnisse, die diese Lücken schliessen, würden zu treffenderen Diagnosen führen, und es könnten Medikamente entwickelt werden, die nicht nur auf die Folgen, sondern auf die Ursache einer Krankheit einwirken. Geeignete Biomarker würden entscheidend zur Strategie einer frühen Intervention beitragen – eine der grössten Hoffnungen für Fortschritte in der Psychiatrie.
Ist das eine utopische Zukunftsvision? Keineswegs: Im Rahmen des Nationalen Forschungsschwerpunkts «Synapsy» arbeiten Forschende aus dem klinischen Bereich und den Neurowissenschaften gemeinsam an Lösungen, wodurch Synergien entstehen. Aufschlussreich war zum Beispiel die Untersuchung darüber, welche Rolle ein Mangel an Antioxidantien im Gehirn bei Psychosen spielt. Ein randomisierter Versuch bei jungen Patienten mit Psychosen hat gezeigt, dass eine Nahrungsergänzung mit einem Glutathion-Vorläufer – dem wichtigsten Antioxidans im Gehirn – bei einer Teilgruppe, die durch Messung des Redoxgleichgewichts im Blut identifizierbar war, eine klinische Verbesserung herbeiführte. Die biologische Wirkung der Behandlung wird dadurch bestätigt, dass der Glutathionspiegel im Gehirn steigt und weisse Substanz wiederhergestellt wird.
Derzeit sind solche Ansätze erst in wenigen psychiatrischen Gebieten von Nutzen. Es sollte jedoch unbedingt weiter geforscht werden. Wenn wir das nicht tun, verweigern wir uns gegenüber Fortschritten, auf die Patienten dringend angewiesen sind. Selbstverständlich würden diese Ansätze nicht auf Kosten der bestehenden Methoden gehen, sondern neue Wege eröffnen, diese zu verbessern.
Philippe Conus leitet die Abteilung Allgemeine Psychiatrie im Universitätsspital Lausanne (CHUV) und ist Professor an der Universität Lausanne.

Bild: Valérie Chételat
Ohne Gehirn gibt es kein psychisches Erleben und somit auch keine psychiatrischen Krankheiten. Doch daraus zu folgern, dass «eine psychiatrische Erkrankung eine Krankheit des Gehirns» sei, wäre ein Trugschluss. Ebenso wäre es fragwürdig zu behaupten, dass wir dank neurobiologischer Kenntnisse über das Gehirn die Psyche verstehen und psychiatrische Störungen besser behandeln könnten.
Die Psyche ist ein emergentes Phänomen, dem zwar neurobiologische Prozesse zugrunde liegen, das aber nicht auf diese zurückgeführt werden kann. Ihre Eigenschaften und vor allem das, was im weiteren Sinne als Bewusstsein bezeichnet wird, existieren nicht in den Stoffen und Prozessen, die das Gehirn bilden, sondern resultieren erst aus deren Interaktion. Mit der Komplexität dieser Interaktionen sind auch die aktuellen Forschungsinstrumente noch überfordert.
Wer Ursachen psychiatrischer Erkrankungen in der Biologie sucht, betrachtet diese essenzialistisch. Eine Diagnose dient dann dazu, eine Krankheit zu etikettieren, indem sie als naturgegebene Tatsache gesehen wird, die schon existiert hat, bevor die Frage gestellt wurde, ob sie existiert. Ich bin aber ein Nominalist und davon überzeugt, dass eine Krankheit nur im Hinblick auf ihre Nützlichkeit zu definieren ist, das heisst nicht «entdeckt» werden sollte, sondern konstruiert. Die Diagnose ist dann eine politische Angelegenheit: das Ergebnis eines gesellschaftlichen Konsenses, der je nach Kontext und Interessen jederzeit ändern kann.
Wer psychiatrische Erkrankungen mit Gehirnkrankheiten gleichsetzt, macht einen Kategorisierungsfehler: Dinge, die zu einer bestimmten Kategorie gehören (hier das Gehirn zur Disziplin Biologie), werden dargestellt, als würden sie zu einer anderen Kategorie gehören (zur Disziplin Psychologie). In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um zwei vollkommen verschiedene Fachgebiete, die nicht aufeinander zurückführbar sind. Dieser Irrtum wäre vergleichbar mit der Behauptung, man könne die künstlerische Genialität von Picasso ergründen, indem man die chemische Struktur der Leinwand und der Farben seiner Gemälde erforscht. Analog wäre es sowohl verwegen zu behaupten, dass Synapsen denken, als auch, dass das Gehirn denkt. Bildgebende Verfahren der Vorgänge im Gehirn zeigen keine Gedanken, Beweggründe oder Gefühle, sondern Korrelate neurobiologischer Abläufe, die – im Idealfall – wiederum mit bestimmten psychischen Phänomenen korrelieren.
Das ist kein Plädoyer gegen die Essenz der wissenschaftlichen Methode, die auf der Erstellung von Hypothesen und ihrer Widerlegung beruht. Doch es ist wichtig, diese korrekt zu formulieren. So wie geologische Hypothesen nicht auf die Soziologie übertragen werden können, müssen wir auch biologische und psychologische Hypothesen auseinanderhalten.
Daniele Zullino ist Professor am Departement für Psychiatrie der Universität Genf und Leiter der Abteilung Addiktologie am Universitätsspital Genf (HUG).




