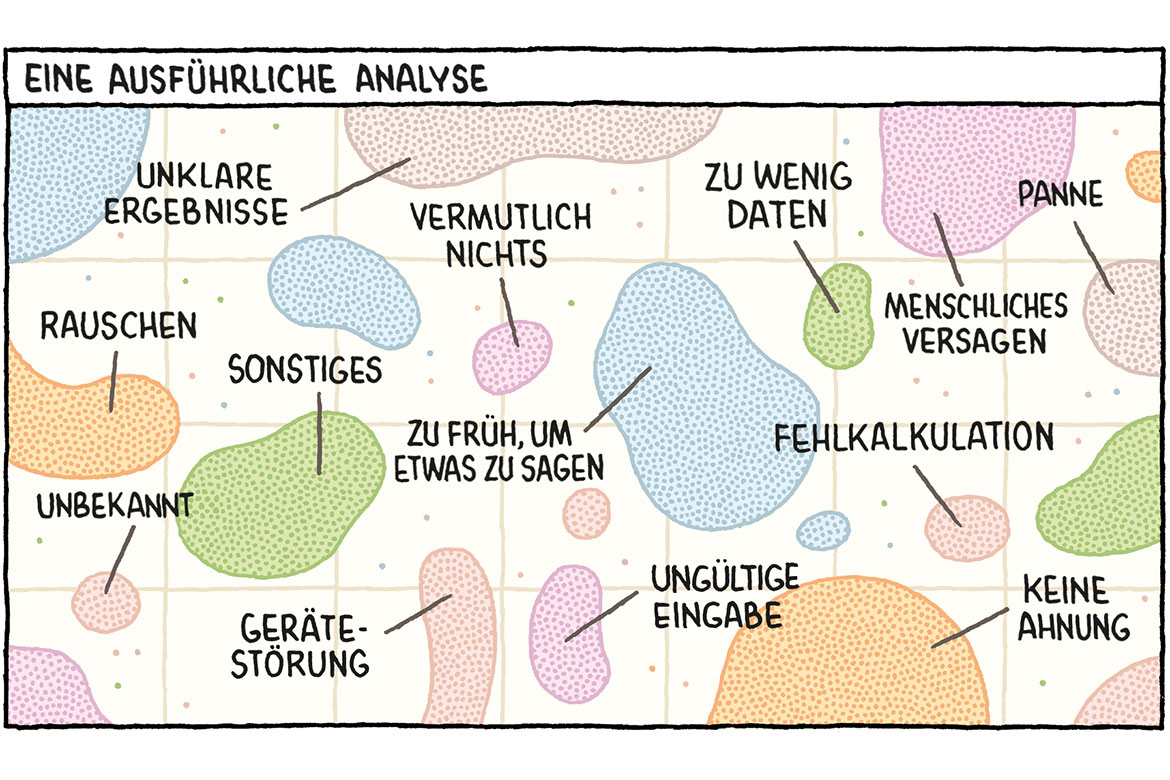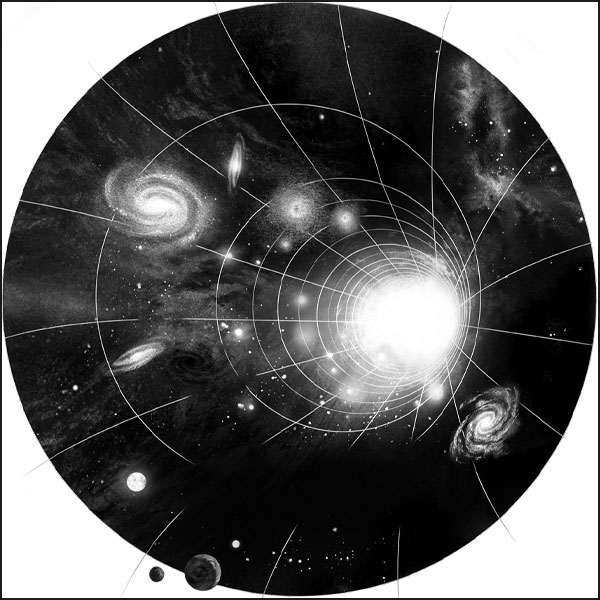Fokus: Die Lehren aus der Pandemie
Nichts mit Entschleunigung
Noch mehr Papers als sonst, kaum Zeit für Begutachtungen und zu viel Modeforschung – drei Forschende erzählen, wie Covid-19 das Tempo in ihrem Alltag noch einmal erhöht hat.

Dass ein Teil der Forschungsförderung wegen der Pandemie zeitweilig fokussiert wird, kann Virologe Volker Thiel nachvollziehen. Ausschreibungen könnten aber auch zu einseitiger Forschung führen.| Bild: SNF; DFG, AER
Seit sich das neuartige Coronavirus auf der Erde ausbreitet, ergiesst sich eine Publikationsflut aus der Forschung in die Fachzeitschriften und auf die Preprint-Server. Es besteht die Gefahr, dass die Qualität der Forschung leidet – trotz aufgestockter Förderung. Die intensive Forschung zu Sars-Cov-2 hat nämlich den Bedarf an fachlicher Begutachtung gesteigert – von Studien wie auch von Förderanträgen. «Ich habe extrem viele Anfragen bekommen», sagt die Virologin Isabella Eckerle von der Universität Genf. Die meisten davon müsse sie ablehnen, da einfach keine Zeit dafür sei. Viele Editoren hätten es im Moment schwer, eingereichte Paper begutachtet zu bekommen, dadurch werde der Reviewprozess oft verlängert. Aktuell könne ohnehin nicht gleich genau begutachtet werden wie vor der Pandemie. Durch den extremen Druck würden in den Journals deswegen nun auch schlechtere Studien erscheinen.
In der Tat wird massenhaft publiziert. Und es muss schnell gehen. Viele Forschende nutzen Biorxiv und Medrxiv. Auf den beiden Preprint-Servern wurden ganze Sammlungen zu Covid-19 zusammengestellt. Bis Ende Juni enthielten diese zusammen schon mehr als 5700 Beiträge – und es gibt noch weitere Sammlungen. Das wirft die Frage auf, wie Fachleute derzeit die Spreu vom Weizen trennen.
Volker Thiel, Virologe an der Universität Bern, hebt die Bedeutung von Twitter für noch nicht begutachtete Ergebnisse hervor. Dort seien viele Forschende vernetzt. «Aufregendes verbreitet sich schnell», sagt er. Ein Problem ist allerdings: Der direkte Austausch über neue Studien ist durch die Kontaktbeschränkungen schwieriger geworden. Viele Konferenzen wurden abgesagt oder in die Online-Welt verlegt. Auch Roland Regös, mathematischer Immunologe an der ETH Zürich, vermisst die persönlichen Treffen. Wichtige Aspekte von Konferenzen könnten online nicht ersetzt werden. Kaffeepausen zum Beispiel lieferten wissenschaftliche Impulse. Eckerle fehlt das Netzwerken in der Community ebenfalls, und Thiel weist auf die mangelnde Gelegenheit hin, an Konferenzpostern detaillierte Fragen zu stellen. Die Konferenzen werden wiederkommen – da sind sich die drei Forschenden einig. Manche Dienstreise allerdings könnte künftig wegfallen. «Man wird sich überlegen, ob man ein bis zwei Tage irgendwohin muss», sagt Thiel.
Nicht nur dem Trend nach
Immerhin fliesst in die Erforschung der Pandemie jetzt viel Geld. Doch die Fokussierung hat auch Schattenseiten. Thiel und Eckerle bedauern, dass langfristigere Vorhaben bei der Förderung nicht berücksichtigt werden. «Bei Projekten mit einer geförderten Dauer von zwei Jahren kann ich zum Beispiel keine Doktorierenden anstellen», sagt Thiel.
Und man solle jetzt nicht nur Themen erforschen, die en vogue sind, meint Eckerle. Antworten auf ganz grundlegende Fragen seien noch nicht bekannt. «Wir verstehen zum Beispiel nicht, warum Viren von Tieren auf Menschen überspringen. » Wichtig sei deshalb die Überwachung des Verbreitungsstandes von Viren bei Mensch und Tier. Und dies erfordert langfristige Förderung.
Bei der grossen Menge an ausgelobten Fördergeldern war das übergeordnete Thema vorgegeben. Das steht in einem gewissen Widerspruch zum Bottom -up-Prinzip, welches etwa bei Projektförderungen des Schweizerischen Nationalfonds gilt. Forschende schlagen die Themen selbst vor. Thiel wünscht sich, dass das auch in Zukunft so bleibt. Dass ein Teil der Forschungsförderung wegen der Pandemie zeitweilig fokussiert wird, kann er jedoch nachvollziehen. Ausschreibungen könnten aber auch zu viele Leute ansprechen, so dass es massenweise sehr ähnliche Anträge gebe – zum Beispiel zur Entwicklung von Tests. So verschwende man Ressourcen für das Schreiben und Begutachten von Anträgen.
Das neue Virus ändert wissenschaftliche Prioritäten. Die Epidemiologie von Infektionskrankheiten werde in der Schweiz ein wichtigeres Thema werden, glaubt Regös. «So eine Pandemie formt die Biowissenschaften im weiteren Sinne.» Die HIV-Pandemie zum Beispiel habe nicht nur die Infektiologie, sondern auch die mathematische Biologie und die Evolutionsbiologie geprägt, indem sie neue, quantitative und evolutionsbiologische Fragestellungen aufgeworfen habe, die sehr relevant für die öffentliche Gesundheit seien.