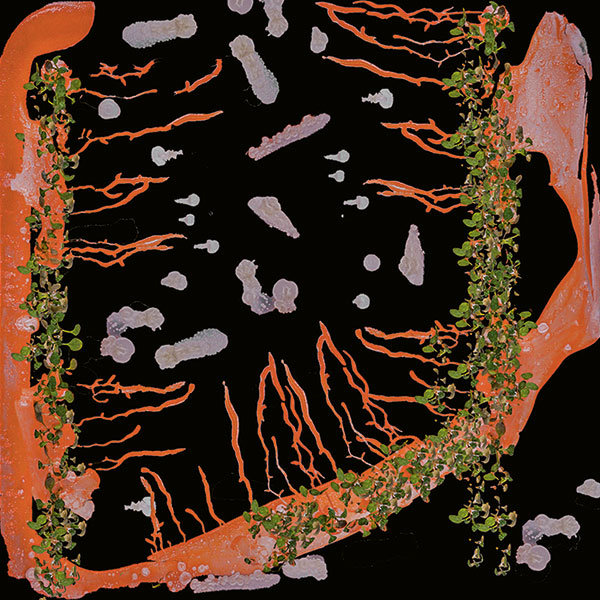Fokus: Die Lehren aus der Pandemie
Plötzlich auf Dauersendung
Im Corona-Medienrummel setzten sich laute Forschende durch. Warum in Zukunft auf die leisen Stimmen gehört und der Stand des Wissens transparent gemacht werden sollte, macht die langjährige Wissenschaftsjournalistin Alexandra Bröhm in ihrem Résumé deutlich.

Auf einmal war wissenschaftlicher Rat teuer – und dringend. Krisensitzung der Taskforce des Bundesamts für Gesundheit Ende Februar 2020. | Foto: Keystone/Pool/Peter Klaunzer
Auf einmal gierte die Öffentlichkeit nach ihren Statements. Forschende waren gefragte Interviewpartner und gern gesehene Talkshowgäste, konnten sich kaum retten vor Medienanfragen, sollten ständig erklären und prognostizieren.
Dieses plötzliche Rampenlicht war Chance und Herausforderung zugleich. Nicht alle gingen gleich damit um. Ein Blick in die Schweizerische Mediendatenbank (SMD) zeigt: Es gab eine Konzentration auf einige wenige Namen. Die anderen suchten die Öffentlichkeit nur sehr selten, obwohl sie Mitglieder der nationalen Covid-19 Science Task Force sind, die der Bund Ende März ins Leben rief.
Erstaunlich ist die Verteilung nicht unbedingt. Ist man den Medien einmal als Expertin bekannt, kommen häufiger Anfragen. Journalisten arbeiten heute unter grossem Zeitdruck, und es geht schneller, bekannte Leute anzufragen, als neue ausfindig zu machen. Gleichzeitig verleiht ihnen der Bekanntheitsgrad Gewicht. Es wäre gut gewesen, mehr Forschende hätten sich selbst zu Wort gemeldet.
Weitaus am häufigsten kommt der Epidemiologe Marcel Salathé von der EPFL in der SMD vor. Er bringt es auf über 1400 Einträge in der Zeit von Mitte Januar bis Anfang Juni 2020. Der breiten Öffentlichkeit war er zuvor nicht bekannt, im Jahr 2019 kam Salathé auf nur neun Einträge. Inzwischen sieht man ihn sogar auf Kampagneplakaten der SBB. Manche mögen das kritisch sehen, aber warum sollte es ein Wissenschaftler den Sportlerinnen, Musikern und Schauspielerinnen nicht gleichtun – gerade in dieser Zeit?
Auf Platz zwei folgt der Epidemiologe Christian Althaus von der Universität Bern mit gegen 700 Einträgen. Er war einer der Ersten, die vor dem neuen Coronavirus warnten. In der Sonntagszeitung sagte er schon am 26. Januar, als die ersten Infektionen in Europa bekannt wurden: «Dieses Virus hat das Potenzial, eine Pandemie auszulösen.»
Auffallend ist, wie wenig forschende Frauen sich während dieser Monate öffentlich zu Wort gemeldet haben. Selbst die Expertinnen aus der Taskforce bringen es nur auf wenige Einträge in der SMD; bei Sarah Tschudin Sutter, leitende Ärztin des Universitätsspitals Basel, sind es sieben bei Samia Hurst, Ärztin, Institutsleiterin und Professorin für Bioethik an der Universität Genf, immerhin fünfzig.
Die Gründe für dieses Schweigen sind vielfältig. Tatsächlich gilt gerade im Bereich der Naturwissenschaften: je höher der akademische Grad, desto weniger Frauen. An der ETH Zürich beispielsweise sind nur rund 14 Prozent der Professuren mit Frauen besetzt. In meiner eigenen Arbeit als Journalistin für den Tages-Anzeiger fällt mir zudem immer wieder auf, dass Frauen, wenn ich sie als Expertinnen anfrage, vorsichtiger und zögerlicher sind, sich mit allgemeinen Einschätzungen zu äussern. Selbst wenn ihre Qualifikationen längst ausreichend wären. Und gerade während der Pandemie mussten sich die Forschenden manchmal auf dünnes Eis begeben, wenn sie eine Einschätzung machten. Männern scheint das leichterzufallen.
Ein Beispiel: Die Anfrage bei einer Forscherin aus der Taskforce liess die Expertin durch die Medienstelle dahingehend beantworten, sie äussere sich nur zu konkreten Studienergebnissen. Ein Anruf bei einem männlichen Kollegen hingegen mündete in einem ausführlichen Interview.
Je länger die Pandemie dauerte, umso schwieriger wurde es zudem, Forschende aus den entsprechenden Fachgebieten überhaupt an den Draht zu bekommen. Das ist zwar verständlich, erschwerte aber meine Arbeit. Fünf Aspekte waren bei der Kommunikation der Forschenden entscheidend. Wie haben sie sich darin geschlagen?
Es war – und ist – eine Herausforderung: Studien entstanden im Schnellzugtempo, kaum erschienen die Manuskripte ohne Begutachtung auf Preprint-Servern, lieferten sie den Medien schon die nächste Schlagzeile. Manchmal ging es sogar so schnell, dass ein Forscher Interviews gab, bevor die Studie überhaupt auf dem Server stand. Dieses rasante Tempo stürzte auch die Schweizer Experten in ein Dilemma. Einerseits wollten sie die Gunst der Stunde nutzen, in der die Wissenschaft derart viel Aufmerksamkeit erhielt, andererseits war zu Beginn vieles noch unbekannt. Nicht alle gingen mit diesem Dilemma gleich um, hatten das gleiche Vorwissen für fundierte Einschätzungen, und nicht immer meldeten sich jene mit dem grössten Fachwissen am lautesten zu Wort.
 «Eine Todesfolge ist genauso selten wie bei einer saisonalen Grippe.»Pietro Vernazza
«Eine Todesfolge ist genauso selten wie bei einer saisonalen Grippe.»Pietro VernazzaDie ersten Wochen ab Ende Januar waren es vor allem der Epidemiologe Christian Althaus und der Biophysiker Richard Neher von der Universität Basel, die Prognosen zum Verlauf der Epidemie machten. Gleichzeitig war jene frühe Phase von der grössten Unsicherheit geprägt. Doch nicht alle blieben deswegen vorsichtig: Der St. Galler Infektiologe Pietro Vernazza meldete sich früh zu Wort und fiel mit Äusserungen auf, die quer standen zur allgemeinen Einschätzung. Im Interview mit der Appenzeller Zeitung sagte Vernazza am 28. Januar über die vom Coronavirus ausgelöste Erkrankung: «Eine Todesfolge ist genauso selten wie bei einer saisonalen Grippe.» Bereits vier Tage vorher hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einem Bericht zu Europa schon vor «schweren Krankheitsverläufen, teilweise mit tödlichem Ausgang» gewarnt. Ausserdem gab es noch zu viele Unsicherheiten, um die Todesraten überhaupt zu erheben.
Selbst Anfang Februar sagte Vernazza in einem Interview mit dem Blick, er bezweifle, dass die Epidemie «wesentlich schwerer verlaufen wird als eine heftige Grippesaison». Ausserdem sorgte er noch vor den ersten Fällen in der Schweiz für Aufregung mit Äusserungen, leichte Fälle würde er in die Heimquarantäne schicken, obwohl zu jenem Zeitpunkt noch jeder einzelne Fall in einem Isolierzimmer im Spital blieb. Einige Wochen später musste Vernazza seine unvorsichtigen Aussagen korrigieren, im Interview mit der Wochenzeitung sagte er am 27. Februar, die Sterblichkeit bei der Grippe liege fünfbis zehnmal tiefer als beim Coronavirus.
Vernazza war auch einer der wenigen, die sich öffentlich gegen Schulschliessungen aussprachen. Im März und April gab es jedoch weder für das Pro noch für das Kontra klare Belege. Alles, was man über Schulschliessungen wusste, beruhte auf Grippeepidemien. Doch diese Daten sind nur beschränkt aussagekräftig, weil Kinder bei der Grippe stark zur Ausbreitung der Krankheit beitragen. Bei Covid-19 war und ist ihre genaue Rolle noch umstritten, doch es deutet immer mehr darauf hin, dass sie sich seltener infizieren als Erwachsene.
Mit Aussagen, für die wissenschaftliche Grundlagen fehlten, fiel auch der Wirtschaftswissenschaftler Reiner Eichenberger von der Universität Freiburg auf. Er beschränkte sich in öffentlichen Auftritten nicht auf Äusserungen zu seinem Fachgebiet, sondern kommentierte medizinische Zusammenhänge. Im Interview mit dem Tages-Anzeiger sagte Eichenberger Anfang Mai über das Coronavirus: «Seine medizinische Gefährlichkeit wurde wohl überschätzt.» Worauf er diese Aussage stützte, machte er nicht klar. Laut BAG waren in der Schweiz bis Ende April innerhalb von zwei Monaten schon 1426 Menschen an Covid-19 gestorben.
 «Das Ziel könnte eine klug gelenkte Durchseuchung sein.»Reiner Eichenberger
«Das Ziel könnte eine klug gelenkte Durchseuchung sein.»Reiner EichenbergerIn der ersten Märzhälfte hatte Eichenberger in einem Interview mit 20 Minuten gesagt: «Das Ziel könnte eine klug gelenkte Durchseuchung sein.» Junge Menschen sollten sich, so der Ökonom, gezielt anstecken, die älteren zu Hause bleiben. Wie unrealistisch dieses Konzept ist, da viele jüngere Menschen auch mit Menschen aus Risikogruppen zusammenleben, und wie die Situation in Schweden eskalierte, wo die Verantwortlichen diese Strategie verfolgten, weiss man heute. Mitte April forderte Wirtschaftsprofessor Eichenberger «Massentests» auf Immunität als Strategie aus dem Lockdown. Wie unzuverlässig die Antikörpertests sind, war aber schon damals ein Thema.
Insgesamt würde ich mir wünschen, dass die Forschenden in Zukunft klar kommunizieren, was der aktuelle Wissensstand und was noch unbekannt ist. Besonders der Online-Journalismus lebt von knackigen Schlagzeilen. Damit umzugehen ist nicht leicht. Klar zu sagen, was man weiss und was nicht, wäre hilfreich.
Begriffe aus der Epidemiologie, die noch im Januar kaum jemand ausserhalb des Fachgebietes kannte, fallen heute in Diskussionen unter Laien. Dennoch sind nicht alle Forschenden gleich versiert darin, ihr Fachwissen auch für ein breites Publikum verständlich zu erklären. In Printmedien ist es jedoch immer auch die Leistung der Journalistinnen, die Statements der Experten so zu formulieren oder einzubetten, dass sie allgemein verständlich sind. Im Radio und im Fernsehen ist dies manchmal schwieriger.
 «Die freiwillige Zustimmung reicht nicht als ethisches Argument für solche Versuche.»Samia Hurst
«Die freiwillige Zustimmung reicht nicht als ethisches Argument für solche Versuche.»Samia HurstPositiv aufgefallen ist in diesem Zusammenhang die Bioethikerin Samia Hurst von der Universität Genf. Sehr klar und dezidiert kommentierte sie die verschiedenen ethischen Dilemmata, die sich während der Pandemie stellten. Egal, ob es um Fragen einer möglichen Triage oder um riskante Impfversuche ging. «Selbst wenn Menschen aus freiem Willen mitmachen wollen und sie alle Risiken verstanden haben, reicht die freiwillige Zustimmung nicht als ethisches Argument für solche Versuche», sagte sie etwa zu diesem Thema am 6. Mai im Tages-Anzeiger.
Viel Aufklärungsarbeit in Sachen Epidemiologie leistete in den ersten Wochen auch Epidemiologe Christian Althaus, als er geduldig und in verständlichen Worten wiederholt erklärte, was der R-Wert bedeutet und wie seine Forschungen ablaufen.
Erstaunt zeigten sich einige Forscher darüber, wie die Publikumsmedien arbeiten. Dies musste wiederum Althaus erleben, als er der NZZ am 26. Februar ein Interview gab und darüber sprach, welche Szenarien uns bevorstehen könnten. Die Journalisten brachten die Zahl von möglicherweise 30 000 Todesopfern, die die Pandemie in der Schweiz fordern könnte, mit ihrer eigenen Frage ins Spiel. Althaus antwortete darauf: «Ein solches Worst-Case-Szenario ist nicht ausgeschlossen.»
Die Pendlerzeitung 20 Minuten Online schrieb darauf das ausführliche Interview zu einem kurzen Artikel zusammen und setzte die 30 000 Toten in den Titel – ein typisches Beispiel für einen Köder im Klick-Journalismus. Auch der Blick ging ähnlich vor. Christian Althaus empörte sich daraufhin auf Twitter: «Ich finde es unverantwortlich, wie @Blickch und @20min mit Worst-Case-Szenarien einer #Covid19-Epidemie Headlines und Clicks generieren. Es gib keinen Grund zur Panik, aber man muss sich auf eine Epidemie vorbereiten. » Althaus zog sich kurz etwas aus den Medien zurück, meldete sich aber schon bald wieder, als die Situation in der ersten Märzhälfte kritischer wurde. Ein NZZ-Journalist fasste am 8. März in einem Kommentar zusammen: «Medien und Wissenschaft sind Systeme, die schlecht zusammenspielen.»
 «Ich finde es unverantwortlich, wie @Blickch und @20min mit Worst- Case-Szenarien einer #Covid19-Epidemie Headlines und Clicks generieren.»Christian Althaus
«Ich finde es unverantwortlich, wie @Blickch und @20min mit Worst- Case-Szenarien einer #Covid19-Epidemie Headlines und Clicks generieren.»Christian AlthausAls Althaus in den Hintergrund getreten war, schlug die Stunde von EPFL-Epidemiologe Marcel Salathé. Er hielt am 26. Februar einen Online-Vortrag über die Coronapandemie und war ab dann omnipräsent in den Medien. Sie lieben ihn, auch weil er sich nicht vor pointierten Aussagen scheut. Dabei hätte die Schweiz eigentlich auch einen Forscher, der sich sehr gut mit Coronaviren auskennt: Der Virologe Volker Thiel von der Universität Bern hielt sich mit Medienauftritten jedoch auffällig zurück. Obwohl er gewiss die Fachkompetenz gehabt hätte, viele Situationen und Entscheide zu kommentieren. Man konnte ihn ab und zu im Gesundheitsmagazin Puls des Schweizer Fernsehens sehen. Mit weniger Zurückhaltung hätte er eine weitere interessante Stimme in die Berichterstattung einbringen können.
Auch bei politischen Entscheidungen spielten die Forschenden plötzlich eine wichtigere Rolle. Obwohl es in der Schweiz etwas länger dauerte als in anderen Ländern. In den ersten knapp zwei Monaten beschwerten sich verschiedene Wissenschaftler wie Marcel Salathé und Christian Althaus, dass das BAG die Forschenden zu wenig beiziehe. So sagte Christian Althaus im Interview mit der NZZ am 26. Februar: «Mir ist aufgefallen, dass bei den Pressekonferenzen der letzten Wochen immer wieder Falschinformationen verbreitet wurden.»
 «In diesen Wochen ist mein Vertrauen in die Politik erschüttert.»Marcel Salathé
«In diesen Wochen ist mein Vertrauen in die Politik erschüttert.»Marcel SalathéIn der ersten Märzhälfte wurde der Ton noch schärfer. Verschiedene Forscher äusserten sich mit deutlichen Worten zu der ihrer Meinung nach zu langsamen Reaktion des Bundes auf die stark steigenden Fallzahlen. «Wir brauchen sofort drastische Massnahmen», sagte der Infektiologe und Genspezialist Jacques Fellay von der EPFL am 13. März im Tages-Anzeiger. Endlich wandte sich am 13. März eine breite Allianz von 25 Forschern und Forscherinnen aus verschiedenen Fachgebieten mit einem offenen Brief an den Bundesrat.
Christian Althaus wunderte sich kurz zuvor, «dass wir die genaue Erfassung der Epidemie schon eine Woche nach Auftreten des ersten Falls in der Schweiz aufgeben». Marcel Salathé schrieb am 21. März auf Twitter: «In diesen Wochen ist mein Vertrauen in die Politik erschüttert.» Die Proteste zeigten Wirkung. Seit Ende März berät die nationale Covid- 19 Science Task Force den Bund.
Trotzdem blieb der Einfluss der Forschenden kleiner, als er sein sollte. Noch immer hörten die Politiker in entscheidenden Momenten nicht auf die Wissenschaft. Das Maskenthema verschlief das Bundesamt für Gesundheit über Monate, obwohl sich verschiedene Experten schon im April klar gegen die offizielle Doktrin von Daniel Koch stellten, wonach Masken nichts nützten. Auch der damalige Leiter der Taskforce, Matthias Egger, hielt am 21. Juni im Interview mit der Sonntagszeitung fest: «In dieser unsicheren Situation halten wir von der Wissenschafts-Taskforce die weiteren Lockerungsschritte für verfrüht.» Der Protest verhallte ungehört. Nur kurze Zeit später jedoch zeigte sich mit den wieder steigenden Fallzahlen, wie recht die Forscher hatten.
 «In dieser unsicheren Situation halten wir die weiteren Lockerungsschritte für verfrüht.»Mattias Egger
«In dieser unsicheren Situation halten wir die weiteren Lockerungsschritte für verfrüht.»Mattias EggerMitten in die politischen Diskussionen geriet im April die ETH-Mathematikerin Tanja Stadler. Am 8. April erschien eine Studie von Stadlers Team über die Wirksamkeit der Massnahmen in der Schweiz. Verschiedene Medien titelten mit der Aussage, dass die Ansteckungsraten bereits vor dem Lockdown abgeflacht seien. Obwohl Stadler in den jeweiligen Artikeln deutlich darauf hinwies, dass die vom Bund verhängten Massnahmen nötig gewesen seien, um den R-Wert entscheidend zu senken. So sagte sie im Artikel des Tages-Anzeigers vom 10. April dazu: «Das darf nicht überinterpretiert werden.» Sie erklärte, dass man bei Modellberechnungen immer mit gewissen Annahmen arbeiten müsse, was zu Verzerrungen führen kann. «Zu sehr in die Daten hineinzuzoomen ist deshalb heikel.» Stadlers Team verfeinerte das Modell danach weiter.
 «Der Zeitpunkt darf nicht überinterpretiert werden.»Tanja Stadler
«Der Zeitpunkt darf nicht überinterpretiert werden.»Tanja StadlerTrotzdem entstand aufgrund der Schlagzeilen eine politische Debatte, ob denn der Lockdown überhaupt nötig gewesen sei. Die Lockdown-Gegner versuchten Stadlers Studie für sich zu instrumentalisieren. Und genau dieser Punkt, dass die Berechnung der Reproduktionszahl immer auch auf gewissen Annahmen basiert, den sie betonte, ging in den Diskussionen unter.
Für Aufregung sorgte Mitte März Neuropathologe Adriano Aguzzi von der Universität Zürich mit einem Youtube-Video, in dem er teilweise von Hand gezeichnete Grafiken in die Kamera hielt. Mit einem leidenschaftlichen Plädoyer forderte er die Zuschauenden dazu auf, zu Hause zu bleiben, damit die Infektionszahlen nicht noch weiter explodieren würden. In einem Interview mit dem Online-Magazin Higgs forderte Aguzzi am 13. März zudem, die Schweiz müsse einen gleich strengen Lockdown durchziehen wie Italien. «Ich habe das Gefühl, die Schweiz sei komplett führungslos», sagte er über die Politik des Bundesrates. Dass die Forderung nach einem kompletten Lockdown übertrieben war, zeigte sich in den nächsten Monaten. Aguzzis Video jedoch, das viel Aufmerksamkeit bekam, hat möglicherweise auch dazu beigetragen, dass die Menschen in der Schweiz den Ernst der Lage zu begreifen begannen.
 «Ich habe das Gefühl, die Schweiz sei komplett führungslos.»Adriano Aguzzi
«Ich habe das Gefühl, die Schweiz sei komplett führungslos.»Adriano AguzziMit ruhigen, besonnenen Auftritten und Aussagen aufgefallen ist während der vergangenen Monate dagegen der damalige Taskforce-Leiter Matthias Egger, Epidemiologe von der Universität Bern. Als es in der NZZ vom 11. Mai darum ging, welche Werte auf die Gefahr einer zweiten Welle hindeuten, sagte er: «Sobald die Zahl der gemeldeten neuen Fälle wieder über 100 steigt und Richtung 200 geht, müsste man wieder über Verschärfungen diskutieren.» Auch wenn es um das Thema Masken ging, bewies Egger wiederholt, dass er für die Leitung der Taskforce die richtige Wahl war.
Die sozialen Medien spielen in der Verbreitung von Nachrichten heute eine zentrale Rolle. Je länger die Pandemie andauerte, umso mehr verbreiteten sich ausserdem gerade dort auch zahlreiche Falschmeldungen und Verschwörungstheorien über das Virus und seine Verbreitung. Umso wichtiger ist es für Forschende, in den sozialen Medien präsent zu sein, um den Falschinformationen etwas entgegenzusetzen.
Am ehesten findet man Wissenschaftlerinnen auf Twitter, wo sie eigene Studien verlinken oder Kommentare zu Studien anderer oder allgemeiner zum Verlauf der Pandemie machten. Wer twittert, erreicht damit vor allem die zahlreichen Journalistinnen, Politiker oder Forscherinnen auf der Plattform. Doch junge Menschen verirren sich kaum auf Twitter. Auf ihren Handys läuft der Nachrichtenaustausch über Instagram, Snapchat, Tiktok oder Whatsapp. Auch auf diesen Plattformen wäre die Präsenz Schweizer Forschender wünschenswert, um die jüngere Generation zu erreichen.
 «Es gibt viele Dinge zu berücksichtigen, die Fallsterblichkeit variiert je nach Ort, Zählweise, der zugrundeliegenden Praxis und der Zeit.»Emma Hodcroft
«Es gibt viele Dinge zu berücksichtigen, die Fallsterblichkeit variiert je nach Ort, Zählweise, der zugrundeliegenden Praxis und der Zeit.»Emma HodcroftZwar hat Epidemiologe Marcel Salathé als einer der wenigen ein öffentliches Instagram-Profil. Der letzte Eintrag datiert jedoch von 2017, Informationen zur Pandemie findet man dort keine. Der Austausch mit der jüngeren Altersgruppe findet also kaum statt.
Doch selbst auf der Forscher-Plattform Twitter sind längst nicht alle Wissenschaftlerinnen in der Schweiz gleich aktiv.
Eine stetige Präsenz in den Pandemiemonaten hatte Molekularbiologin Emma Hodcroft vom Basler Biozentrum, die Mutationen des Coronavirus erforscht. Sie postete in den Monaten Februar bis Juni oftmals täglich zwischen 15 und 20 Tweets und Retweets. Wer ihr folgte, der bekam einen sehr guten Eindruck von ihrer Arbeit, der ihrer Kollegen und der aktuellen Lage. So thematisierte sie beispielsweise am 28. März die Tücken der Fallsterblichkeit (Case Fatility Rate) und warum diese sich von Land zu Land so stark unterscheidet: «Es gibt viele Dinge, die man berücksichtigen sollte, die Fallsterblichkeit variiert immer abhängig von Ort, Zählweise und der zugrundeliegenden Praxis und – vielleicht am wichtigsten – der Zeit.» Es folgte eine Serie von zehn Tweets zum Thema.
 «Hier ein kurzer Thread über ein paar ziemlich beunruhigende Fehlinterpretationen zum Begriff ‹asymptomatisch›.»Nicola Low
«Hier ein kurzer Thread über ein paar ziemlich beunruhigende Fehlinterpretationen zum Begriff ‹asymptomatisch›.»Nicola LowAktiv auf Twitter waren auch Forscherinnen, die in den traditionellen Medien weniger zu Wort kamen. So hatte Epidemiologin Nicola Low von der Universität Bern eine stetige Präsenz mit täglichen Tweets und Retweets. Sie nahm am 4. April das Thema der asymptomatischen Verläufe auf: «Hier ein kurzer Thread über ein paar ziemlich beunruhigende Fehlinterpretationen zum Begriff ‹asymptomatisch› und seine Bedeutung für uns.» Wer den Forscherinnen folgte, bekam wertvolle zusätzliche Informationen zur aktuellen Studien- und Pandemielage.