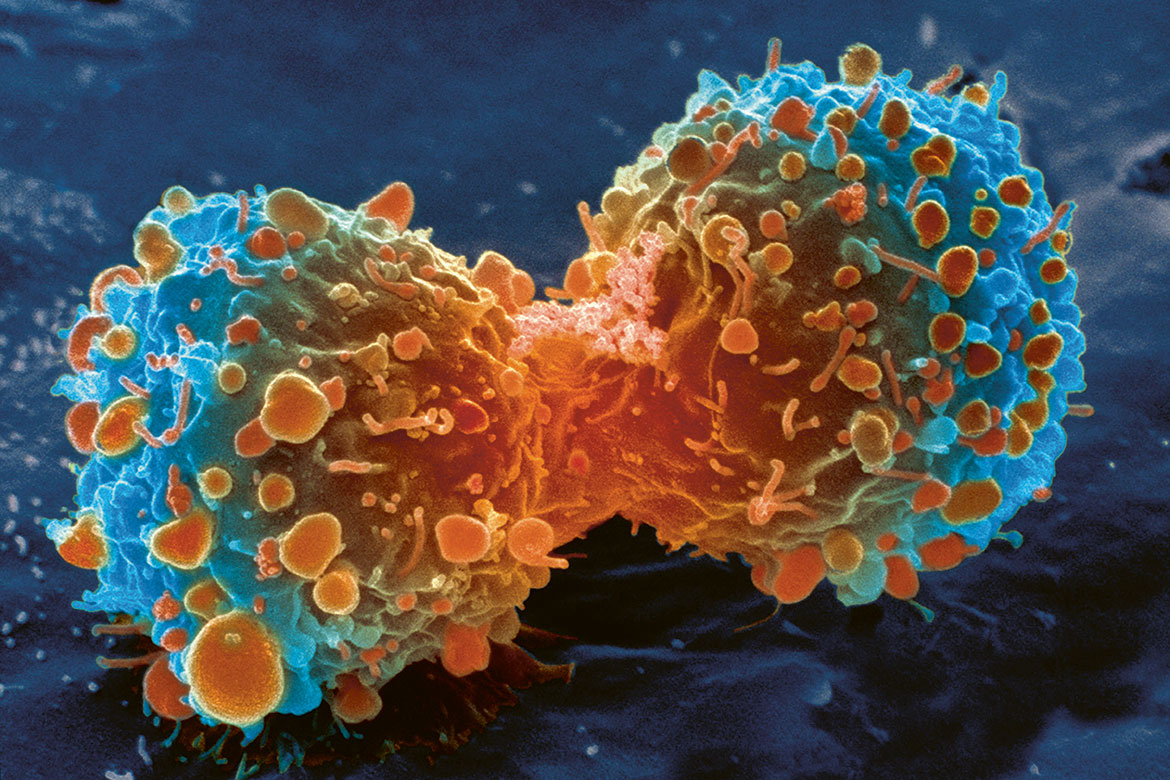Fokus: Diversität an Hochschulen
Aufgefallen! Versuche rund um die Welt
Der Einbezug aller gesellschaftlichen Gruppen ist in der akademischen Welt zu einer Priorität geworden. Acht Beispiele zeigen ein Kaleidoskop möglicher Massnahmen.
Die Hochschulen müssen inklusiver werden und Benachteiligte besser integrieren. Dieses Ziel ist anerkannt, sowohl ethisch als auch rechtlich und strategisch. Mögliche Massnahmen gibt es zahlreiche: von Integrationsprogrammen über Sensibilisierungskampagnen bis zu Reglementsänderungen.
Doch inklusiver zu werden, ist nach wie vor eine Herausforderung. Jedes System schafft solide, homogene Machtstrukturen, die gegenüber Veränderungen natürlicherweise Widerstand leisten. Die getroffenen Massnahmen werfen zudem heikle Fragen auf: nach umgekehrter Diskriminierung, Verhältnismässigkeit, Bürokratie und – allen voran – Effizienz. Die grosse Diversität an Beteiligten, Bedürfnissen und Zielen sowie an Kulturen und rechtlichen Rahmenbedingungen erklärt, weshalb zur Förderung der Diversität ganz unterschiedliche Massnahmen eingesetzt werden.

Frauenquote 100 Prozent
Das Projekt war einzigartig und radikal: Am 17. Juni 2019 gab die Technische Universität Eindhoven (TUE) bekannt, dass neue Professuren in den nächsten fünf Jahren nur noch an Frauen vergeben würden, ausser wenn eine Vakanz sechs Monate lang nicht mit einer Forscherin besetzt werden kann. Innerhalb von weniger als einem Jahr kamen so 35 Wissenschaftlerinnen neu zur Institution. Der Ansatz wurde geschätzt, denn die niederländische TUE hat einen der niedrigsten Frauenanteile der Hochschulen in Europa.
Wie immer bei Quoten besteht die Gefahr, dass Frauen, die von diesem Programm profitieren, vorgeworfen wird, sie seien nur wegen ihres Geschlechts und nicht aufgrund ihrer Qualifikation berufen worden. «Über meine Ernennung habe ich das nicht gehört», meint die Architekturprofessorin Deniz Ikiz Kaya, die 2020 zur TUE gestossen ist. «Es stand ausser Zweifel, dass meine Qualifikationen sehr gut dem gesuchten Profil entsprechen.» Doch eine neue Professorin in einer andern Abteilung habe eine solche Erfahrung gemacht: Ein Kollege meinte «zum Spass» zu ihr, dass sie nur da sei, weil sie eine Frau sei. «Ich denke nicht, dass das lustig ist.»
Männer beschwerten sich jedoch über Benachteiligung. Und sie fanden Gehör: Am 3. Juni 2020 erklärte das niederländische Institut für Menschenrechte in einem Gutachten, dass die TUE «zu weit gegangen» sei und dass sie die Situation in den einzelnen Fakultäten hätte berücksichtigen müssen, da der Frauenanteil unterschiedlich hoch ist. Das Institut empfiehlt, zuerst die üblichen Gleichstellungsmassnahmen zu stärken. Doch damit ignoriert es, dass diese bisher keine grosse Wirkung gezeigt hatten und die Universität genau deswegen ein zwar radikales, aber zumindest klares Experiment wagte. Die TUE hat nun die Initiative unterbrochen und will sie den Empfehlungen des Instituts für Menschenrechte anpassen.

Beunruhigende Selbsterkenntnis
Ein 15-minütiger Online-Test entlarvt unbewusste Vorurteile. So lautet zumindest das Versprechen des Project Implicit, das ein Team der Harvard University seit rund 20 Jahren anbietet. Wetten, dass das Ergebnis das Bild erschüttert, das Sie von sich selber haben? Das Prinzip ist einfach: Ein Test misst, wie schnell Wörter kategorisiert werden, und offenbart signifikante Unterschiede. Viele Testpersonen benötigen zum Beispiel mehr Zeit, um das Wort «Biologie» der Kategorie «Frau oder Wissenschaft» zuzuweisen als der Kategorie «Mann oder Wissenschaft». Dieser Unterschied zeugt von einem unbewussten Vorurteil, das Naturwissenschaften eher mit dem männlichen als mit dem weiblichen Geschlecht assoziiert.
Das Experiment kann eine Schockwirkung entfalten. Denn es zeigt auf frappierende Weise, dass nicht nur unsere Überzeugungen zählen, sondern auch implizite Vorstellungen, mit denen wir Menschen und Identitäten auf eine offensichtlich fragwürdige Art schubladisieren.
In der Privatwirtschaft werden Workshops zu impliziten Vorurteilen im Rahmen von Gleichstellungsmassnahmen organisiert. Auch die akademische Welt geht das Problem an: Die EPFL empfiehlt solche Workshops, die Universität Zürich bietet sie seit September 2019 an. «Mögliche Vorurteile bewusst zu machen, ist der erste Schritt dazu, sie abzubauen», schreibt die Liga Europäischer Forschungsuniversitäten. Über die konkreten Effekte besteht bisher noch kein Konsens.
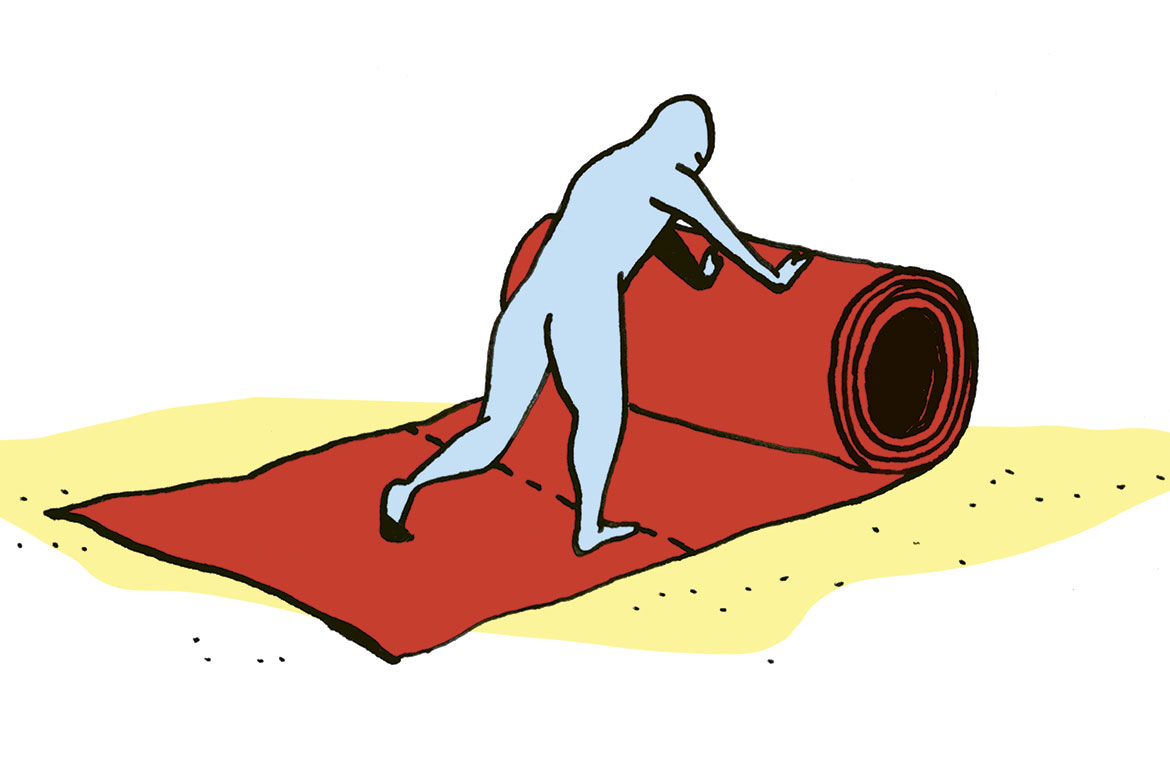
Stilles Örtchen für alle
Männer-WC, Frauen-WC: Diese scheinbar einfache Zuteilung kann für Transmenschen und intergeschlechtliche Menschen zum Problem werden: Sie müssen eine Wahl treffen, die ihnen nicht entspricht, sie werden beschimpft, wenn sie die WCs benutzen, die ihrem erlebten Geschlecht entsprechen, oder dürfen sie gar nicht betreten. Es gibt eine relativ einfache Lösung: nicht geschlechtsspezifische Toiletten, die allen offenstehen. 2018 stiess die Ankündigung der ersten offiziellen Unisex-WCs an der Universität Köln auf Kritik, insbesondere wegen der angeblich hohen Kosten, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete.
Die Idee hat ihren Weg auch in die Schweiz gefunden. Nach Verzögerungen aufgrund rechtlicher Hindernisse haben erste Restaurants nicht geschlechterspezifische Toiletten. Die Fachhochschule Luzern präsentierte Anfang 2020 drei Unisex-WCs. An der ETH Zürich gibt es 147 solche WCs und 19 Unisex-Duschkabinen. Und es gibt noch andere Initiativen in diesem Bereich: An der ETH können Vorname und Anrede geändert werden, ohne dass dafür ein formeller Entscheid vorzulegen ist, eine nicht binäre Formel ist hingegen nicht möglich.
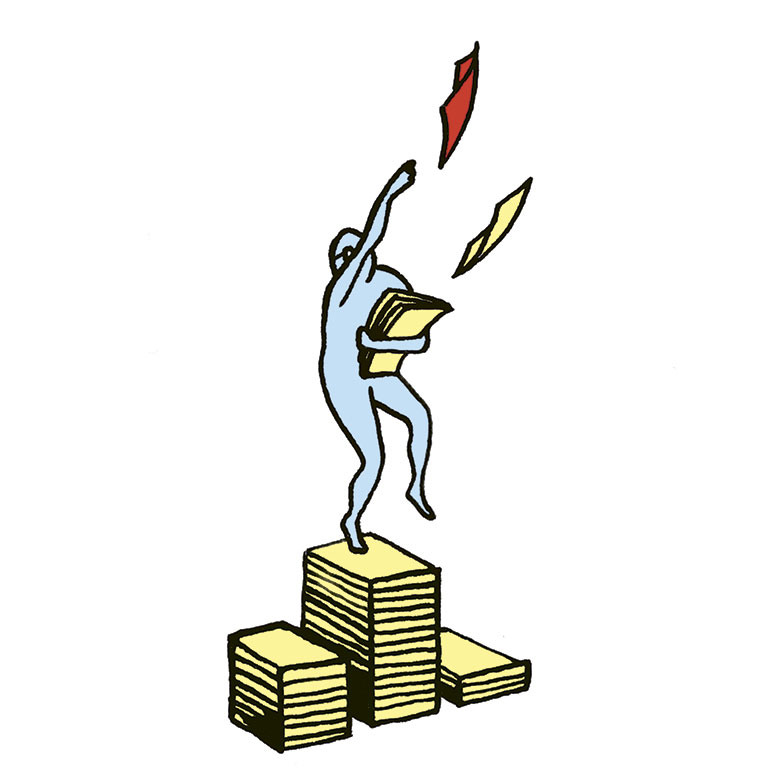
Zertifikat für gute Inklusion
Hochschulen und Wissenschaftspolitik berücksichtigen heute auch die Chancengleichheit in ihren strategischen Ausrichtungen. Doch wie lässt sich überprüfen, dass es nicht bloss bei Lippenbekenntnissen bleibt, sondern wirksame Massnahmen ergriffen werden?
Eine Möglichkeit besteht darin, zu messen, zu kontrollieren und zu bewerten. Die britische Vereinigung Advance HE zertifiziert seit 2005 gute Praktiken für Gleichstellung und Inklusion an Hochschuleinrichtungen. Mit dem Athena- Swan-Label lässt sich zudem zeigen, dass der Gleichstellung grosse Bedeutung beigemessen wird und sich eine Einrichtung im internationalen Wettbewerb um akademische Talente profilieren kann. Und noch mehr: Beim britischen National Institute for Health Research zum Beispiel können sich für gewisse Forschungsgelder nur Institutionen bewerben, die mindestens die Auszeichnung Silber von Athena Swan haben.
Die britische Regierung hat allerdings am 10. September 2020 erklärt, für die von ihr bereitgestellten Finanzierungen nicht mehr länger das Athena-Swan-Label zu verlangen. Sie empfiehlt den Universitäten, «zu bedenken, dass die Verwendung freiwilliger Labels eine unnötige Bürokratie darstellt und das akademische Personal von den Aktivitäten abhält, die im Zentrum der Lehre stehen». Das Label, das von den Gebühren der Universitäten lebt, könnte deshalb verschwinden.
«Es stimmt, dass Athena Swan in den letzten Jahren schwerfällig geworden ist», erklären in einer offiziellen Stellungnahme die Mitglieder der Lenkungsgruppe, die das Programm reformieren will. «Doch man soll das Kind nicht mit dem Bade ausschütten.» Die Gruppe schlug im März 2020 deshalb 41 Empfehlungen vor, die Athena Swan wirksamer und transparenter machen sollen.
Die Schweiz kennt kein ähnliches Label. Die Universitäten erstellen aber Aktionspläne für Gleichstellung, die von der Dachorganisation Swissuniversities evaluiert werden, damit sie Beiträge an deren Umsetzung beantragen können. Die Akkreditierung der Hochschulen, die durch die Schweizerische Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung erfolgt, umfasst ebenfalls Indikatoren zur Gleichstellung, allerdings ohne vertiefte Analyse der Massnahmen und der Wirksamkeit. Kein Vergleich also mit Grossbritannien.
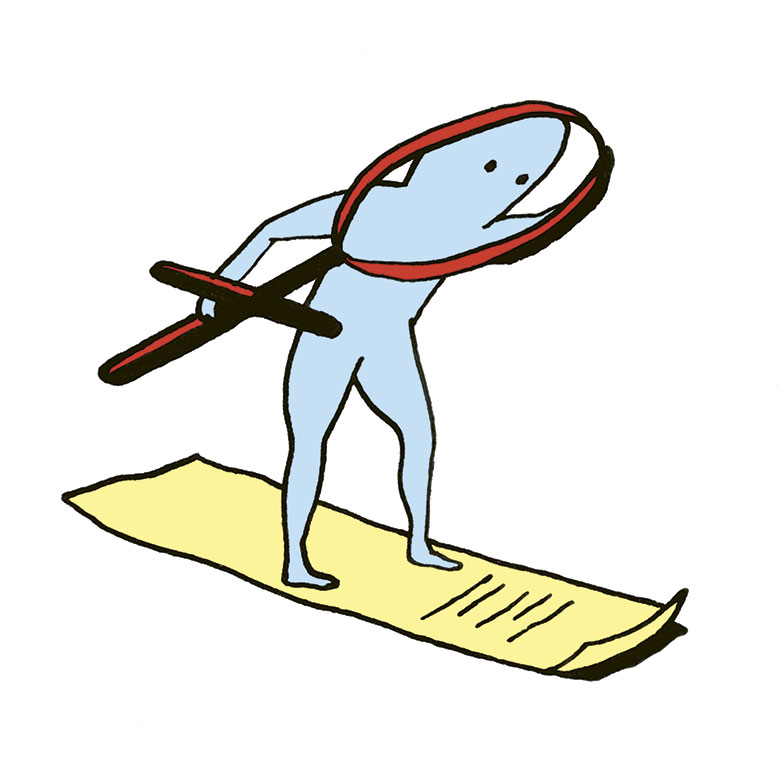
Die Richtigstellerin von Wikipedia
Den Namen Oladele Ogunseitan kennen wohl nur wenige. Der Experte für öffentliche Gesundheit und Umweltgesundheit mit nigerianischen Wurzeln ist auf seinem Gebiet sehr bekannt und wurde kürzlich zum Presidential Chair der University of California in Irvine sowie in die American Association for the Advancement of Science ernannt. Trotzdem gab es über ihn keine Biografie auf Wikipedia, bevor Jess Wade am 28. November 2020 eine solche publizierte.
Die 32-jährige britische Physikerin redigiert jede Woche mehrere Seiten über bedeutende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an Hochschulen zu Minderheiten gehören: Frauen, Forschende in Entwicklungsländern oder aus der LGBTIQ*-Community. Sie will ihnen damit die Sichtbarkeit geben, die sie verdienen. In drei Jahren hat sie 1000 neue Seiten auf Wikipedia verfasst: von der Physikerin Heather Williams bis zur Gesundheitsspezialistin Nisreen Alwan.
Regeln weicher auslegen
Es überrascht nicht, dass diese Initiative mit mehr oder weniger zivilisierten Diskussionen einhergeht, zum Beispiel im Fall von Clarice Phelps: Die afroamerikanische Chemikerin hat an der Reinigung von Berkelium mitgewirkt. Damit gelang 2010 die Synthese eines neuen Elements des Periodensystems: Tenness. Zweimal wurde die Seite über sie von den Herausgebenden von Wikipedia gelöscht, weil es an unabhängigen Quellen zur Bekanntheit von Phelps fehlte. Nach einer Debatte in den Medien wurde die Seite schliesslich wieder aufgeschaltet. In den sehr langen Diskussionen zwischen den verschiedenen Herausgebenden von Wikipedia prallten zwei Sichtweisen aufeinander; einerseits die strenge Anwendung der Regeln der Enzyklopädie dazu, welche Art von Artikel erscheinen darf, andererseits eine weichere Auslegung der Regeln mit der Begründung, dass unabhängige Quellen zur Bekanntheit einer Person für Menschen aus Minderheiten eben einfach seltener sind.
Die Mission von Jess Wade scheint Erfolg zu haben: Weniger als ein Prozent ihrer Seiten wurden gelöscht. Ihre Idee wurde ausserdem offiziell bei Editathons aufgenommen. Bei diesen Events sind Internetnutzende aufgerufen, Wikipedia-Seiten über Persönlichkeiten zu verfassen. Ein von SRF und Ringier am 26. November 2020 organisiertes Event dürfte rund 50 neue Einträge hervorgebracht haben. Neu zu finden ist zum Beispiel Anne Lévy, die Direktorin des Bundesamts für Gesundheit, oder auch die Architektin Annette Gigon. Immer noch vergeblich sucht man in der Schweiz tätige renommierte Wissenschaftlerinnen wie Vanessa Wood, Vizepräsidentin der ETH Zürich, oder Brigitte Galliot, Vizerektorin der Universität Genf.
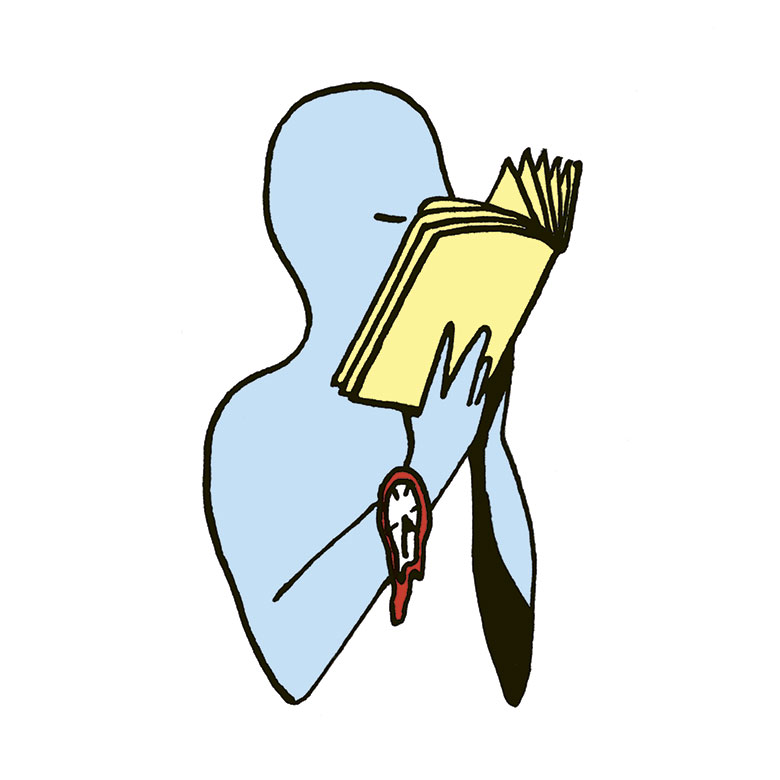
Mehr Zeit bei Handicaps
Die Bundesverfassung und die von der Schweiz ratifizierten internationalen Abkommen verbieten Diskriminierungen. Sie verlangen aber auch, dass der Staat positive Massnahmen ergreift, um Ungleichheiten auszuräumen, und dass er sicherstellt, «dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung haben», wie Swissuniability auf ihrer Internetseite in Erinnerung ruft. Die Organisation berät sowohl die Hochschulen als auch Menschen mit Behinderung, die studieren möchten.
Wichtig sind etwa der physische Zugang zu den Kursen, Assistenzen oder eine Verlängerung der Studiendauer. Bei Prüfungen kann eine Hochschule mehr Zeit geben, einen separaten Raum organisieren oder die Form der Prüfung (mündlich oder schriftlich) anpassen. Die ETH Zürich zum Beispiel hat 2018 nach eigenen Angaben 80 Gespräche mit 60 Studierenden geführt, um Lösungen zu finden.
Zehn anstatt vier Jahre
Ein Fall war aber anders. Die Hochschule verweigerte Jürg Brechbühl, der an den Folgen einer Hirnverletzung leidet, den Zugang zum Master in Umweltwissenschaften. Ein Arztzeugnis wies eine Studienfähigkeit von 20 Prozent aus, womit sein Studium gemäss Berechnung der ETH Zürich zehn Jahre dauern würde, also wesentlich länger als die normale Höchstdauer von vier Jahren. Doch der Berner nahm sich einen Anwalt und gewann vor der Rekurskommission der ETH Zürich, insbesondere weil er bereits ein Austauschsemester bezüglich Credits zu 77 Prozent erfolgreich bestritten hatte. Seither ist er immatrikuliert und fühlt sich gemäss einem Artikel im Tages-Anzeiger von den Mitstudierenden gut akzeptiert.
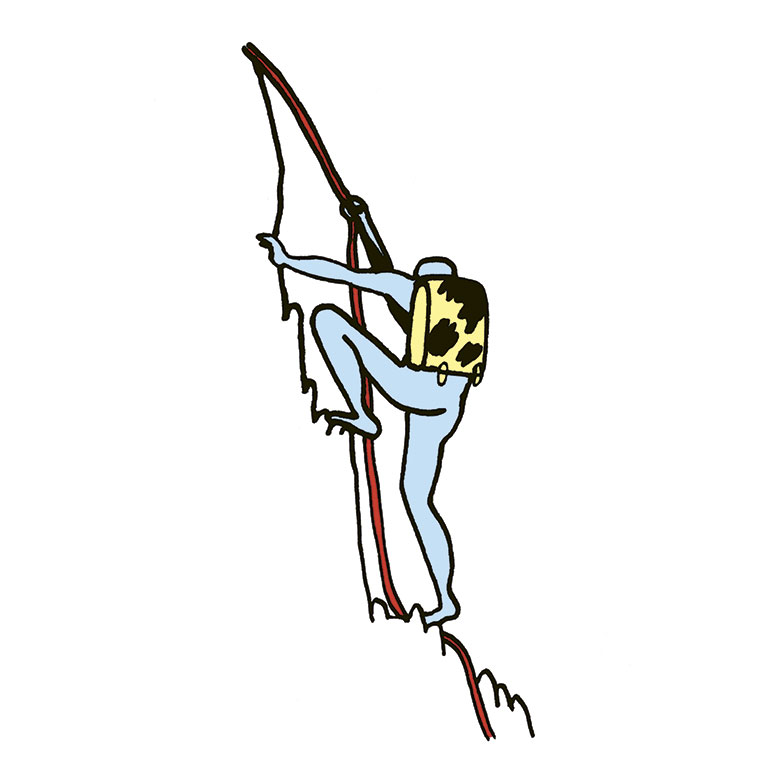
Hilfe beim Einstieg an die Uni
Der französische Präsident Emmanuel Macron kündigte im September 2020 an, dass er die Zahl der Plätze im Programm «Les cordées de la réussite» von 80 000 auf 200 000 erhöhen wolle. Dieses wurde 2008 lanciert und fördert den Zugang zur höheren Bildung für Jugendliche aus benachteiligten Schichten. Es setzt auf Mentoring: Studentinnen und Studenten von Universitäten begleiten Jugendliche an einer Mittelschule oder einer Berufsschule, die aufgrund eines schwierigen sozialen Kontexts als «prioritär» eingestuft sind. Ziel ist es, «Selbstzensur» zu vermeiden, denn diese Jugendlichen sehen häufig selbst dann von einem Studium ab, wenn ihre bisherige Schulzeit erfolgreich war.
Privilegierte bleiben privilegiert
Trotz der Politik Frankreichs mit einem «Bac pour tous» – 80 Prozent sollen eine Berufs- oder gymnasiale Maturität erwerben – bestehen weiterhin soziale Ungleichheiten. Nur vier von zehn Jugendlichen aus benachteiligten Schichten absolvieren eine höhere Bildung, gegenüber sieben von zehn aus privilegierten Schichten.
Ein ähnliches Programm existiert in Deutschland: Die Vereinigung Arbeiterkind.de begleitet und berät Kinder aus nicht universitärem Umfeld auf ihrem Weg zu einem Studium mit der Hilfe von 6000 Freiwilligen. Auch hier bestehen auffallende Ungleichheiten: Lediglich 23 Prozent der Jugendlichen ohne Elternteil mit Hochschulabschluss absolvieren eine höhere Bildung, gegenüber 83 Prozent aus Familien mit akademischem Hintergrund.
Die Schweiz wird häufig gelobt für ihr duales Bildungssystem und die Durchlässigkeit zwischen den Ausbildungswegen. Doch auch hier ist der soziale Aufstieg nicht die Regel: Drei von zehn Jugendlichen aus benachteiligten Schichten studieren, aber fünf von zehn aus privilegierten Schichten.

Brutale Realität virtuell erzählen
«Als ich vom Chef des Personalrestaurants gerügt wurde, zu spät zur Arbeit zu kommen – an einer Konferenz, bei der ich meine Arbeiten präsentierte.» – «Ich möchte Ihnen Jonathan vorstellen. Er ist … ähm … unsere neueste Minderheitsrekrutierung. » – «Ein Sicherheitsmann auf dem Campus, der mich kennt, aber die Polizei anrief, damit sie meine Identität überprüft.» Das sind einige aus Tausenden von Tweets über Erfahrungen, die afroamerikanische Forschende gemacht und unter dem Hashtag #BlackInTheIvory gepostet haben.
Indem sie vielfältige Erlebnisse sammeln, öffnen Hashtags wie #BlackInTheIvory und #MeToo der Öffentlichkeit die Augen für eine wenig wahrgenommene Realität von Diskriminierungen, Aggressionen, Exklusion und Verständnislosigkeit. Vor allem aber bieten sie den Direktbetroffenen eine Plattform.
Manche zweifeln diese Geschichten vielleicht an – denn die sozialen Netzwerke sind weder Gerichte noch etablierte Medien. Doch es sind dieselben Geschichten, die auch bei strukturierten Befragungen Betroffener zu hören sind. Etwa bei @PayeTonEPFL, das im November 2020 von der Studierendenvereinigung der EPFL lanciert wurde und von einem ungesunden Klima auf dem Campus erzählt: homophobe Gesänge an offiziellen Abenden, sexuelle Belästigungen bei Übungen und sexistische Bemerkungen, auf die ohrenbetäubende Stille folgte.
Illustrationen: Julia Marti