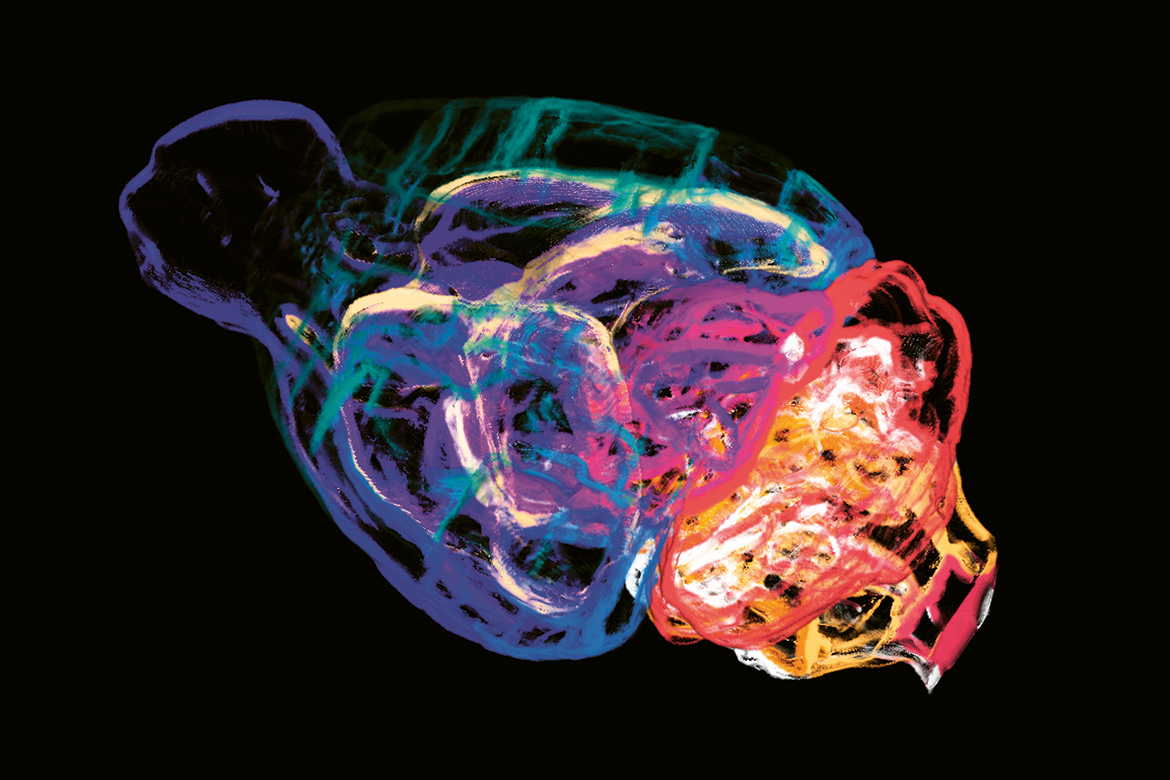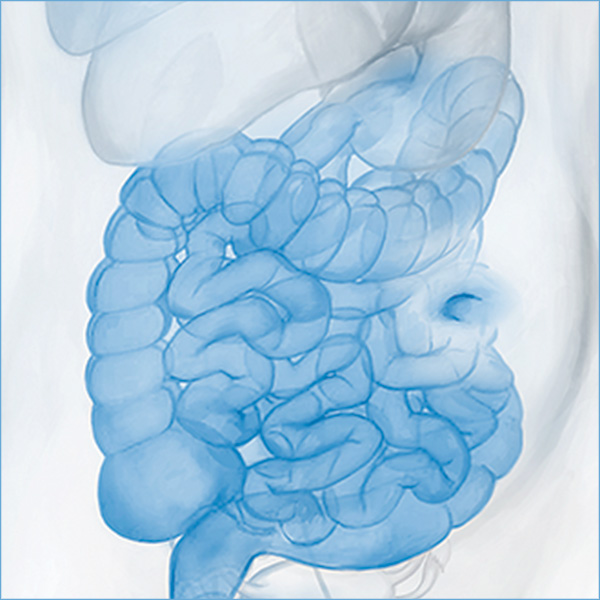Fokus: Diversität an Hochschulen
Die Vielfalt der Vielfalt
Eine Klage gegen eine US-amerikanische Universität war die Initialzündung für die moderne Diversitätsbewegung an Hochschulen. Ihre Geschichte und wie sie gedeutet wird, ist so vielfältig wie das, was in ihrem Namen erreicht werden soll. Ein Rundblick.

Vivian Malone war eine der ersten Afroamerikanerinnen, die eine Universität besuchten. Hier geht sie durch eine Menschenmenge, zu der Fotografen, Mitglieder der Nationalgarde und der stellvertretende US-Generalstaatsanwalt gehören. Die Mathematikerin war später die erste afroamerikanische Person, die in das Executive Committee der Association for Women in Mathematics gewählt wurde. | Foto: K. Warren Leffler/Library of Congress
Allan Bakke fühlte sich ungerecht behandelt. Der weisse Kalifornier konnte einen besseren Notendurchschnitt vorweisen als einige seiner afroamerikanischen Mitbewerbenden, trotzdem verweigerte ihm die University of California 1973 und 1974 den Zugang zum Medizinstudium. Die Universität hatte eine feste Quote – 16 von 100 Studienplätzen – eingeführt, um Minderheiten bessere Chancen zu geben. Der studierte Ingenieur und Vietnam- Veteran Bakke war bereits 34, als er sich für ein Medizinstudium entschied, und wurde deswegen als zu alt abgewiesen.
Bakke klagte, bezog sich nun aber nicht auf sein Alter, sondern auf die Quote für Minderheiten, die seine Chance verringern würde. Diese sogenannten Affirmative-Action-Programme seien nicht in der Verfassung verankert. Seine Klage landete 1978 schliesslich vor dem obersten amerikanischen Gericht. Der Supreme Court entschied zwar, Bakke müsse zum Studium zugelassen werden, gleichzeitig betonten die obersten Richtenden aber, dass Programme, die sich gegen Benachteiligungen einsetzten, also positive Diskriminierung, notwendig seien. Deswegen gilt das Urteil als Meilenstein in der Geschichte der Diversity an Hochschulen und in der Forschung.
Ästhetische Diversitas im antiken Rom
Die Forderungen nach Diversität sind in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend hörbar und selbstbewusst geworden– Zeit also, das Schlagwort unter die Lupe zu nehmen: Zunächst einmal bedeutet Diversität schlicht Verschiedenheit. Doch der Begriff hat eine längere Geschichte, verschiedene Bedeutungsebenen und kommt in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen vor. Schon lange bevor er in den letzten Jahrzehnten in politischen und sozialen Debatten wichtig wurde. Dass Diversität ein positiver Wert ist, den man anstreben sollte, fand man schon in der Antike. Vor allem in der römischen Kultur galt Diversität (lateinisch: diversitas) als wichtige ästhetische Kategorie. Schliesslich war das grosse Reich selbst ein sehr diverses Gebilde und setzte auch in der polytheistischen Religion auf Vielfalt. Übernommen haben dieses Denken, trotz des Wechsels zum Monotheismus, sogar christliche Autoren wie Augustinus. Nun galt es einfach Gott über «die Vielfalt der Erscheinungen seiner Welt zu preisen», schreibt der deutsche Philosoph und Biologe Georg Toepfer in seinen «Bemerkungen zur Begriffsgeschichte der Diversität». Der positiv geprägte Hintergrund hat laut Toepfer dazu beigetragen, dass sich Diversität Ende des 20. Jahrhunderts sozialpolitisch zu einem wichtigen Begriff entwickeln konnte.
Vielfalt im Jahre 1992 gehört Biodiversität zu den wichtigsten Schlagworten der globalen Debatten über Umweltpolitik und Umweltschutz.»Thomas Kirchhoff
Politische Entwicklungen der 70er-Jahre verliehen der Debatte Schwung und trugen dazu bei, die Forderungen verschiedener Gruppen unter einem Schlagwort zu einen. Es war – wie das Beispiel des Supreme-Court-Urteils zeigt – der Kampf um gleiche Rechte für afroamerikanische Bürgerinnen und Bürger in den USA, aber auch der internationale Kampf um mehr Frauenrechte. Zwar ist der Zugang für Frauen an einzelne Schweizer Universitäten theoretisch schon seit den 1860er-Jahren möglich. Doch bei den akademischen Karrieren sind die Forderungen nach mehr Gleichberechtigung oder Diversität noch immer aktuell.
Die «Totalitarismuserfahrungen des 20. Jahrhunderts» und das daraus resultierende «Erschrecken über sich selbst» hätten den Debatten in den letzten 30 Jahren in der Forschung und an den Hochschulen Auftrieb gegeben, schreibt Toepfer. Genauso wie das «pluralistische Denken der postmodernen Philosophie ». Mit ihr lässt sich die Welt nicht mehr mit einer grossen übergeordneten Erzählung erklären, sondern es gibt viele unterschiedliche Perspektiven.
Es gibt noch eine prägende Bedeutungsebene: In der Biologie ist Diversität eine wichtige Kategorie. Vor allem seit der Unterzeichnung des Rio-Übereinkommens über die ökologische Vielfalt im Jahr 1992 ist die Biodiversität zu einem «wichtigen Schlagwort öffentlicher Debatten» geworden, wie der deutsche Philosoph Thomas Kirchhoff im Sammelband «Diversität als Kategorie, Befund und Norm» schreibt. Zwar sind die Ziele nicht ganz die gleichen: Hier geht es darum, eine vorhandene Vielfalt zu bewahren. In der politisch- sozialen Debatte lautet die Forderung dagegen, eine in der Gesellschaft vorhandene Vielfalt auch in den Inhalten und Strukturen abzubilden. Trotzdem soll die positiv konnotierte Biodiversitätsbewegung laut Toepfer den Diversitätsdiskussionen an den Hochschulen geholfen haben: Weil die schwindende Vielfalt in Flora und Fauna als so entscheidend gilt, wird sie auch sonst als wichtig erkannt.
Mehr Menschen, mehr Perspektiven
Dass Diversität schwierig zu definieren ist und für verschiedene Forderungen stehen kann, hat dem Erfolg des Konzepts nicht geschadet, ihm vermutlich sogar geholfen. Auch in der Wissenschaft hat der Begriff mehrere Ebenen. Einerseits geht es darum, dass die Gemeinschaft der Forschenden vielfältiger wird, dass also Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen in der Wissenschaft tätig sind. Andererseits geht es um die inhaltliche Komponente: Auch bei den Fragestellungen, mit denen sich die Forschenden beschäftigen, soll der Fokus erweitert werden. Hinzu kommt nach wie vor die Frage nach dem Zugang an die Hochschulen, eine der ersten Forderungen und die Initialzündung der Debatte.
Das Geschlecht, der soziale und der ethnische Hintergrund, das Alter, die sexuelle Orientierung, mögliche körperliche Beeinträchtigungen und die geografische Herkunft sind heute alles Aspekte, welche die Diversitätsdebatten mitbestimmen. «Aufholbedarf gibt es in der Schweiz vor allem bei der sozialen Herkunft», sagt die Soziologin Gaële Goastellec von der Universität Lausanne, die zum Thema forscht. «Es spielt noch immer eine zu grosse Rolle, dass die Eltern selbst gut gebildet sind, wenn es darum geht, welche Kinder ins Gymnasium und schliesslich an die Hochschulen kommen.» Bei Mädchen falle dieser Faktor sogar noch stärker ins Gewicht als bei Jungen. Das sei in allen europäischen Ländern ausser Finnland der Fall.
Gleichzeitig sei die Forderung nach Gleichberechtigung der Geschlechter aber jener Teil der Diversitätsdebatte, der am breitesten Anerkennung finde. So hat die EU im Dezember 2020 angekündigt, dass in ihren Horizon-Forschungsprogrammen bei der Mehrheit der Eingaben in Zukunft das Geschlecht sowohl bei der Zusammensetzung der Teams als auch als Kategorie innerhalb des Forschungsprojekts berücksichtigt werden muss. Eine Expertengruppe unter der Leitung der Wissenschaftshistorikerin Londa Schiebinger vom Institut für Gender-Forschung der Stanford University hatte für die EU einen Bericht zum Thema ausgearbeitet. Dabei ging es vor allem darum, zu zeigen, wie alle davon profitieren können, wenn biologisches und soziales Geschlecht und damit eine diverse Sicht in die Forschungen einfliessen.
Als Beispiel nennt Schiebinger das Schicksal der Meeresschildkröten am australischen Great Barrier Reef. Die Temperaturen entscheiden mit, welches Geschlecht ihre Jungen eher haben. Ist es wärmer, produzieren sie mehr weibliche Nachkommen. Eine australische Studie habe anhand der Geschlechtsverteilung dieser Tiere die Klimaveränderungen aufzeigen können. Und Forschungsarbeiten zu Technologiefolgen, die Kategorien wie Gender oder Ethnie berücksichtigen, konnten zeigen, dass Algorithmen nicht wertneutral agieren, sondern dass sich in ihnen gesellschaftliche Stereotypen spiegeln. Auch in der Medizin sind Geschlecht und Ethnie wichtige Kategorien: Medikamente wirken bei Frauen teilweise anders, und die ethnische Herkunft ist einer der Faktoren, der vermutlich die Schwere einer Covid-19-Erkrankung mitbestimmt. Übrigens: Auch Männer profitieren, wenn das Geschlecht in der Medizin mehr beachtet wird. Lange glaubte man etwa, dass vor allem Frauen an der Knochenschwäche Osteoporose erkranken, dabei leiden auch ältere Männer teilweise schwer darunter.
Bereicherung mit Konfliktpotenzial
Dass divers zusammengesetzte Teams bessere Resultate liefern, diese Einsicht setzte sich in der Wirtschaftswelt zuerst durch. «Von dort sickerte die Erkenntnis auch in den Wissenschaftsbetrieb », sagt Benedetto Lepori, Professor für Kommunikationswissenschaften an der Università della Svizzera italiana, der zum Thema Diversität an Hochschulen forscht. Unternehmen gehe es darum, mit Vielfalt ihre ökonomische Effektivität zu steigern, schreibt auch Philosoph Georg Toepfer. «Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund bringen eine Vielfalt an Meinungen, Perspektiven und Erfahrungen mit», sagt Renate Schubert, Professorin für Nationalökonomie und Delegierte für Chancengleichheit an der ETH Zürich. Dies wirke bereichernd und verbessere die Resultate für alle. Allerdings sei der Prozess oft kostenintensiver. «In divers zusammengesetzten Teams kommt es tendenziell zu mehr Konflikten», sagt Schubert. Erstaunlich sei das nicht, aber auch kein Problem, wenn man geeignete Ressourcen einsetze, um die Konflikte zu entschärfen und produktiv zu nutzen. «Solche Investitionen lohnen sich auf jeden Fall.»
Das haben schon zahlreiche Studien gezeigt, etwa die Analyse von mehr als 9 Millionen Papers, die 2018 in Nature Communications erschienen war. Die Autorinnen belegen unter anderem, dass diverse Teams einen grösseren Impact entfalten und um mehr als 10 Prozent häufiger zitiert werden. Und eine im vergangenen Jahr in PNAS erschienene Auswertung von Dissertationen aus den USA zwischen 1977 und 2015 wies nach, dass «unterrepräsentierte Gruppen» in dieser Zeitspanne mit ihren Arbeiten ein höheres Innovationspotenzial erreichten. «Es entstehen viel mehr neue Ideen und kreative Ansätze, wenn man Teams divers zusammenstellt», ist Lepori überzeugt.
Lepori sieht es wie Goastellec: Die Schweiz hat vor allem beim Zugang zu Bildung Aufholbedarf. Das bestätigt auch ein Bericht des Schweizer Wissenschaftsrats im Jahr 2018, der zeigte, dass Kinder von akademisch gebildeten Eltern eine sieben Mal höhere Chance auf eine Maturität haben als Kinder von Eltern ohne Hochschulabschluss. Selbst die sogenannte Durchlässigkeit nach der Sekundarschule mit den Kurzgymnasien käme meist Kindern von besser gebildeten Eltern zugute.
Die Schaffung der Fachhochschulen habe in diesem Zusammenhang zwar zu einer gewissen Diversifizierung und Demokratisierung geführt, sagt Lepori. So ist nach abgeschlossener Berufsbildung der akademische Weg einfacher möglich als früher. Trotzdem findet er, es brauche noch mehr Anstrengungen. Auch Lösungen, die auf den ersten Blick unattraktiv erscheinen, müsse man durchdenken, beispielsweise ein nach Einkommen gestuftes Schulgeld. «Ich sage nicht, das wäre die ideale Lösung, aber jetzt profitieren von der mit Steuergeldern finanzierten Gratisbildung vor allem Kinder gut gebildeter Eltern.»
Und Allan Bakke? Nach dem Urteil des Supreme Court begann er 1978 im Alter von 38 Jahren sein Medizinstudium, erstritt sich vor Gericht noch finanzielle Unterstützung und arbeitete nach Abschluss des Studiums als Anästhesist an der Mayo-Klinik. Möglich wäre ein solch später Einstieg theoretisch auch in der Schweiz.