Wissenschaftskommunikation
Forschende tweeten fleissig
Über Twitter informieren sich Forschende über neue Ergebnisse, tauschen
sich aus und lassen die Öffentlichkeit an ihren Analysen und
Schlussfolgerungen teilhaben. Die Plattform hat aber auch ihre Tücken.
Twitter gehört für viele Forschende zum Berufsalltag. Ein neues Ausmass an Aufmerksamkeit erreichten sie mit ihren maximal 280 Zeichen langen Beiträgen seit Beginn der Pandemie. Mit knackigen Erklärungen liessen Expertinnen und Experten die Öffentlichkeit direkt an Studienergebnissen teilhaben. Unter ihnen war auch Christian Althaus von der Universität Bern, ehemaliges Mitglied der Covid-19-Taskforce des Bundes. «Anfangs ging es darum, innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu kommunizieren», so der Epidemiologe. Man habe nicht warten wollen, bis ein Preprint einer Studie erscheine und Resultate deswegen direkt auf der Plattform geteilt und diskutiert. «Im Februar und März sind unsere Aktivitäten dann vermehrt von der Öffentlichkeit wahrgenommen worden.»
Tweet wird ganze Zeitungsseite
Althaus, der über 19 000 Follower zählt, schaltete sich auch in die Debatte zu den Massnahmen gegen die Bekämpfung der Pandemie ein. Er sieht es als seine Aufgabe an, Fakten zu kommunizieren und Falschinformationen zu korrigieren. Weil er dabei kein Blatt vor den Mund nimmt, blies die Boulevardpresse einige seiner Tweets, in denen er zum Beispiel von einem «politischen Totalversagen der Schweiz» sprach oder eine Politikerin als «Hobby-Epidemiologin» bezeichnete, schon mal zu einer ganzen Zeitungsseite auf. «Mittlerweile überlege ich ein bisschen länger, welche Worte ich wähle», so Althaus.

Doch längst nicht alle Forschenden mischen sich auf Twitter aktiv ein. Viele nutzen die eigene Timeline auf passive Weise, um im Meer der Publikationen, Preprints und Working Papers den Durchblick zu bewahren. Und sie schätzen die Vernetzung mit ihren Kolleginnen und Kollegen. So auch der Pflanzenbiologe Etienne Bucher, der bei Agroscope in Nyon arbeitet und der schon 2010 auf der Plattform aktiv wurde. «Damals war ich Postdoc in Genf und über Twitter konnte ich sehr gut mit Top Shots im Feld diskutieren.» So sei er mit einem renommierten Forscher ins Gespräch gekommen. Als er ihn später auf einer Konferenz traf, habe sich über die gemeinsame Twitter-Aktivität sogleich ein Anknüpfungspunkt ergeben.
Viel Aufwand für wenig Gehör
Neben dem Networking nutzt Bucher den Kurznachrichten-Dienst für die Wissenschaftskommunikation. Als Beispiel führt er eine kürzlich erschienene Studie an, die sich mit der Identifizierung von Pflanzen beschäftigte, die mit der Genschere Crispr-Cas9 verändert wurden – ein wichtiger Punkt in der Debatte um neue Pflanzenzüchtungstechniken. Bucher analysierte die Resultate dieser Studie genauer und zeigte auf, dass sie zu einer falschen Schlussfolgerung führen konnte. Seine eigene Analyse beschrieb er in einem Thread, also in mehreren gleich nacheinander folgenden Tweets. Daraufhin kontaktierten ihn sogar Verantwortliche der Europäischen Union, um Genaueres zu erfahren. «Ohne Twitter hätte ich meine Analyse nicht veröffentlicht, das hätte zu viel Zeit in Anspruch genommen», so Bucher.

Eine andere Erfahrung mit Threads hat die Klimaforscherin Sonia Seneviratne von der ETH Zürich, der über 5000 Twitternutzer folgen. Sie verfasste eine Nachrichtenfolge zur Frage, wieviel Klimawandel der Planet noch verkraften kann. «Er wurde von fast 1000 Leuten geteilt». Doch sie hat Vorbehalte: «Es braucht sehr viel Zeit einen guten Thread zu machen». Und gleichzeitig verschwinde diese aufwändige Textkomposition schon nach kurzem wieder aus den Timelines. «Ich frage mich, ob ich nicht lieber einen permanenten Blog-Eintrag hätte schreiben sollen.» Ausserdem sei sie nicht sicher, ob ihre Aufklärungsarbeit viele Leute ausserhalb der Wissenschaftscommunity erreicht habe.
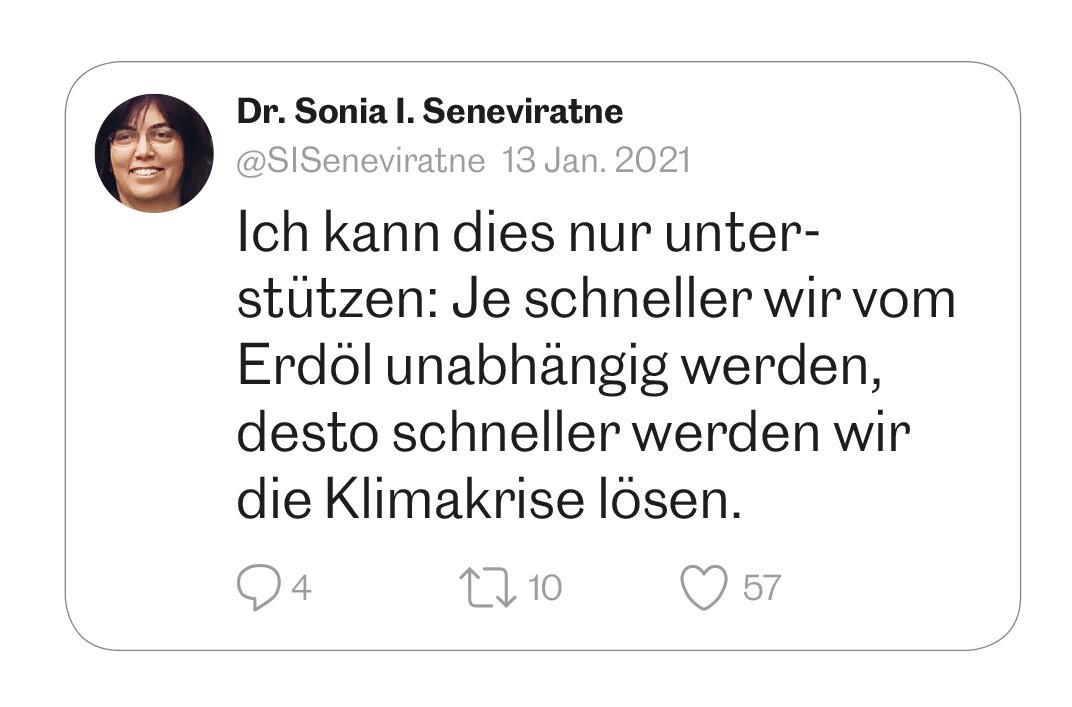
Diese Reflexion trifft den Nagel auf den Kopf: Erreicht das akademische Gezwitscher die Bevölkerung überhaupt? Nur etwa 10 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer besitzt einen Twitteraccount, die Mehrzahl der Nutzenden stammen aus Medien, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.
Trotzdem können Themen aus der Wissenschaft über den Kurznachrichtendienst manchmal breitere Kreise erreichen, zum Beispiel indem sie von Medienmachenden aufgegriffen werden. Damit hat die Ökonomin Monika Bütler von der Universität St. Gallen Erfahrung. Sie betreibt mit zwei Kollegen einen Blog zur Schweizer Wirtschaftspolitik und nutzt Twitter unter anderem, um neue Einträge zu bewerben. «Es gab eine Zeit, da wurden fast ein Drittel unserer Beiträge von den Medien aufgenommen», so Bütler. Wie stark das Interesse sei, hänge von der Aktualität des Themas ab.

Haben sich Forschende erst einmal Reichweite verschafft, kann es aber Probleme geben, zum Beispiel, wenn man falsch verstanden wird. So ist es der Psychologin Angela Bearth von der ETH Zürich ergangen, die regelmässig über Forschungsergebnisse zu Konsumverhalten tweetet. Ein Tweet zu ihrer Studie, in der sie Gründe für irrationale Sorgen um Chemikalien untersuchte, erhielt über einen Retweet sehr viel Aufmerksamkeit. Sie habe zunächst konstruktive Kritik aus der Wissenschaft erhalten. Allerdings hätten dann einige Chemiker und Toxikologinnen die Studie auch falsch interpretiert, nämlich dahingehend, dass Menschen, die Angst vor Chemikalien hätten, einfach «zu blöd» seien.
Sie habe zwar versucht dies zu berichtigen, sagt Bearth, doch habe ihr die Fehldarstellung dennoch einige erboste Kommentare eingebracht: Sie sei von der Chemieindustrie bezahlt und angestellt, um der Bevölkerung giftige Chemikalien schmackhaft zu machen. «Es ist zwar schön, wenn unsere Arbeit gelesen wird, aber damals habe ich auch erfahren, dass manche Leute aus den Resultaten das machen, was sie eben machen möchten.» Diskutieren und Kommentieren bringe in diesem Fall wenig.
Beleidigende Kommentare
Erfahrung mit unsachlichen Kommentaren haben die meisten Forschenden und oft ignorieren sie solche Beiträge einfach. Doch in seltenen Fällen können solche Kommentare beleidigend sein, wie auch die St. Galler Ökonomin Monika Bütler erlebt hat. Zu Beginn der Pandemie hatte sie auf die Wirksamkeit von Massnahmen hingewiesen, unter anderem der Maskentragpflicht, und diese Tweets wurden in den Medien aufgegriffen. Nun wurde ihr in Kommentaren vorgeworfen, dass sie die psychologischen Folgen der Massnahmen zur Begrenzung der Pandemie leugne. «Ich wurde zum Beispiel immer wieder von den gleichen Leuten als Suizidleugnerin bezeichnet» so Bütler. «Bei solchen wiederholten, persönlichen Angriffen habe ich begonnen die Accounts zu blocken.»

Es gebe bestimmte Themen, bei denen solche Angriffe häufiger vorkämen, sagt die Silke Fürst von der Universität Zürich, die die öffentliche Kommunikation von Hochschulen erforscht. «Ein Beispiel ist die Genderforschung.» Neben dem Blocken, Stummschalten, vorsichtigeren Formulieren oder Kontern könne es helfen, wenn sich andere Forschende in eine Diskussion einmischten und einer angegriffenen Person so den Rücken stärkten, so Fürst.
Die Vernetzung auf Twitter hat ihre Schattenseiten, doch dient sie dem wissenschaftlichen Austausch und dem Anliegen der Wissenschaftskommunikation, mehr Forschung in die Gesellschaft zu bringen.




