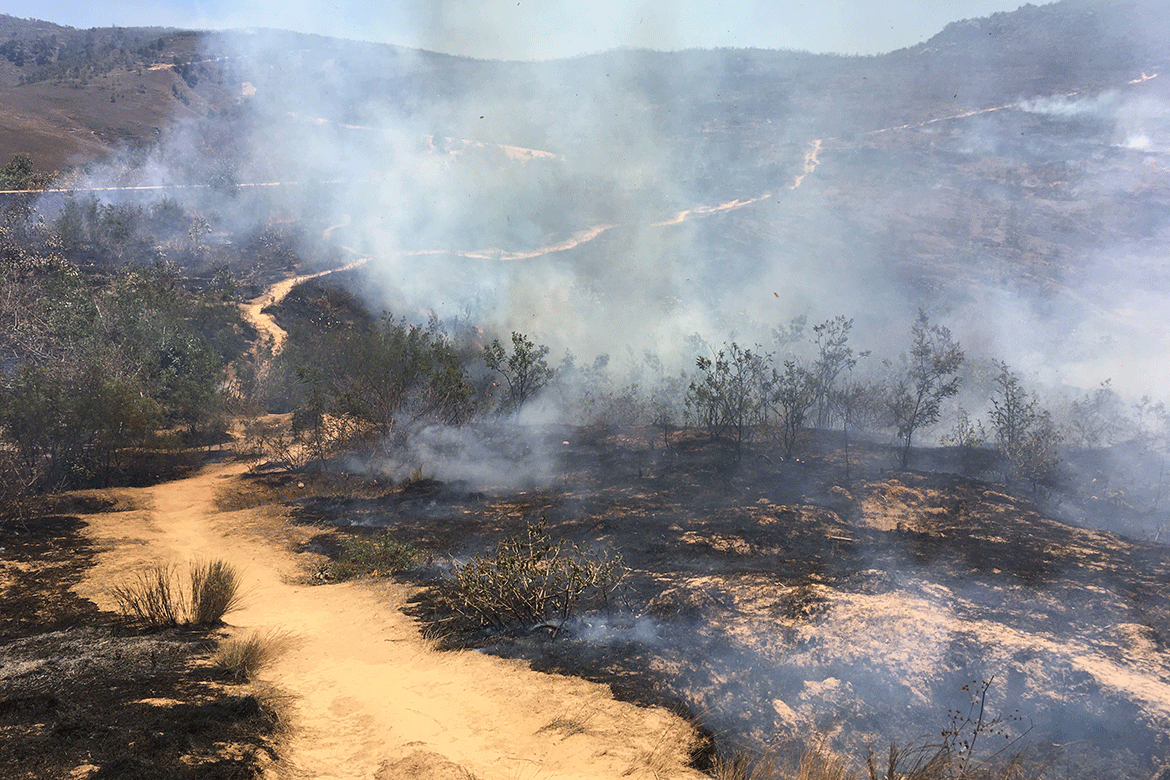TIERVERHALTEN
Was du mir gibst, gebe ich dir auch
Ameisen schuften für ihre Königin, Ratten verteilen Leckerbissen, Fische bieten Begleitschutz: Tiere scheinen oft selbstlos zu handeln. Warum sie das tun, ist umstritten.

Buntbarsche verteidigen ihr Territorium gegen Eindringlinge. Gruppenmitglieder müssen dabei den dominanten Paaren bei der Aufzucht helfen, sonst werden sie bestraft. | Foto: Michael Taborsky
Das Räderwerk der Evolution ist unerbittlich. Nur wer überlebt und sich fortpflanzt, kann seine Gene weitergeben. In der Natur, so scheint es jedenfalls, schaut deshalb jede und jeder für sich selbst. Und doch: Hilfsbereitschaft ist im Tierreich weit verbreitet. Mehrere Hundert Arbeiterinnen tragen Pollen ins Erdhummelnest, um die Larven ihrer Königin zu ernähren. Junge Schleiereulen putzen ihren Geschwistern das Gefieder und geben ihnen Futter ab. Guppy-Fische begleiten Artgenossen, die sich einem Räuber nähern, um seine Gefährlichkeit einzuschätzen. Weshalb geben sie sich derart uneigennützig?
«Weil sich ihr Verhalten letztlich auch für sie selber lohnt», sagt der Verhaltensbiologe Michael Taborsky von der Universität Bern. Er erforscht seit über 40 Jahren Kooperation und Hilfsbereitschaft bei verschiedenen Tierarten. Zum Beispiel bei Wanderratten. Die sozialen Strukturen, in denen diese Tiere leben, hängen stark von der Umwelt ab. Mancherorts besetzt eine Kernfamilie, bestehend aus einem Weibchen und ihren Jungen, ein kleines Territorium. Andernorts schliessen sich bis zu 200 verwandte und nicht verwandte Individuen zu einer Art Clan zusammen. Sie schlafen in gemeinsamen Nestern, putzen einander das Fell und tauschen Nahrung aus.
Tiere helfen einander auch unter Laborbedingungen, wie Taborsky und seine Mitarbeitenden nachgewiesen haben. Sie brachten Ratten bei, ein Brett heranzuziehen, worauf eine andere Ratte im Nachbarabteil Zugang zu einem Leckerbissen bekommt. Solche Geschenke verteilt ein Tier aber nur, wenn es auch selbst von Hilfsbereitschaft profitiert – ein Prinzip, das in der Biologie Gegenseitigkeit oder Reziprozität genannt wird (siehe Kasten rechts). Die Forschenden fanden dabei heraus: Hat eine Ratte ein Geschenk erhalten, verhält sie sich künftig allen Artgenossen gegenüber spendabler. Die Wanderratten zeigen sich aber auch gezielt erkenntlich. So ziehen sie Futter viel eher für hilfsbereite Artgenossen heran als für Geizhälse. In einem Experiment erhielten Tiere mehr Nahrung zurück, wenn sie ihren Partnern begehrte Bananenstücke statt unbeliebtere Rüebli verschafft hatten.
Offenbar erinnern sich Wanderratten genau daran, wer ihnen schon einmal geholfen hat und wer nicht. Für eine kürzlich publizierte Studie untersuchte Taborskys Team Ratten, die jeweils vier Artgenossen nacheinander begegnet waren. Nur von einem bekam das Versuchstier jeweils einen Leckerbissen. Als fünf Tage danach die Rollen getauscht wurden, gaben die Versuchstiere den grosszügigen Partnern viel mehr Futter als den übrigen – ungefähr so viel, wie sie selbst von ihm erhalten hatten. «Die Tiere achten also darauf, nicht von egoistischen Artgenossen ausgenützt zu werden», sagt Taborsky. Nur so geht die Rechnung des Tauschhandels für sie auf. Den Ratten hilft dabei ihr gutes Gedächtnis – und ihr Geruchssinn. Wie die Berner Forschenden ebenfalls kürzlich herausgefunden haben, können Wanderratten nämlich riechen, ob ihr Gegenüber kooperativ oder knausrig ist. «Wir wissen noch nicht, wie dieser Geruch entsteht. Aber wahrscheinlich ist er ein sogenannt ehrliches Signal, das Ratten nicht manipulieren können», sagt Taborsky.
In freier Wildbahn sind die Kooperationsbedingungen nicht immer derart fair wie in den Rattenexperimenten. Taborsky erforscht auch das Sozialverhalten des Buntbarsches Neolamprologus pulcher, der im ostafrikanischen Tanganjikasee lebt. Ein dominantes Brutpaar wird bei der Aufzucht der Larven und Jungfische von Gruppenmitgliedern unterstützt. «Arbeitet ein solcher Helfer nicht richtig mit, wird er gebissen oder gerammt und im schlimmsten Fall verstossen», erzählt Taborsky. Alleine überlebt ein solcher Buntbarsch aber nicht lange. «Das untergeordnete Tier wird in diesem Fall also zur Mitarbeit gezwungen », sagt Taborsky, «sein Nutzen ist, dass es Raubfeinden nicht zum Opfer fällt.»
Altruismus ist im Interesse der Gene
Doch Tiere können auch selbstlos handeln: Bei über 900 Vogelarten etwa verzichten Jungvögel zuweilen darauf, eine eigene Familie zu gründen, und helfen stattdessen ihren Eltern, weitere Bruten aufzuziehen. Und bei manchen Insekten wie etwa Bienen und Wespen bilden sich ganze Staaten, in denen sich zeitlebens nur eine einzige Königin fortpflanzt. Das Paradebeispiel für eine solch hochsoziale Lebensweise sind Ameisen. Je nach Art existiert in Ameisenstaaten eine Arbeitsteilung mit über einem Dutzend unterschiedlichen «Berufen»: Manche Arbeiterinnen füttern die Larven, manche entsorgen Abfälle, manche gehen auf Nahrungssuche. Allen gemein ist, dass sie zeitlebens kinderlos bleiben. Trotzdem kommt es nie zu einem Aufstand gegen die Königin. «Das ist nur möglich, weil die Ameisen in einem Staat nahe miteinander verwandt sind», sagt Ameisenforscher Laurent Keller von der Universität Lausanne.
In der Biologie spricht man von Verwandtenselektion. Der britische Forscher William Hamilton erkannte in den 1960er-Jahren, dass ein Tier nicht selber Nachkommen zeugen muss, um seine Gene weiterzugeben. Evolutionsbiologisch gesehen profitiert es auch davon, wenn Verwandte sich vermehren können. Mit seiner Schwester zum Beispiel teilt ein Tier die Hälfte seines Erbguts. Trägt seine Hilfe dazu bei, dass die Schwester zwei Nachkommen mehr aufziehen kann als alleine, entspricht das dem Wert eines eigenen Jungtiers.
In Ameisenkolonien sind die Arbeiterinnen sehr eng miteinander verwandt, und gemeinsam sind die Tiere äusserst produktiv. «Das ist der Grund, weshalb sich Altruismus bei ihnen so prominent entwickeln konnte», sagt Keller. Im Grunde sind also auch Ameisenarbeiterinnen nur vordergründig selbstlos. Sie helfen einander, weil sie so mehr eigene Gene an die nächste Generation weitergeben können. Für Laurent Keller ist klar: Die Verwandtenselektion ist die treibende Kraft hinter hilfsbereitem Verhalten im Tierreich – bei Altruismus immer, bei Reziprozität meistens. In den meisten Gruppen, in denen sich Zusammenarbeit finde, sei die Verwandtschaft enger, als wenn Tiere zufällig zusammengewürfelt würden. Das vereinfache aus evolutionsbiologischer Sicht die Entstehung von Hilfsbereitschaft. «Vögel leisten zum Beispiel gegenüber Verwandten mehr und häufiger Bruthilfe als gegenüber Nicht-Verwandten.»
Michael Taborsky sieht das etwas anders. Dass echter Altruismus wie im Ameisennest nur unter Verwandten entstehen könne, sei unbestritten, sagt er. Aber Reziprozität gebe es auch ohne Verwandtschaft. Ratten würden nicht verwandten Tieren sogar bereitwilliger helfen – schliesslich könnten sie erst dadurch ihre Chancen erhöhen, in Zukunft etwas zurückzubekommen. Wichtig sei auch der Zustand des Empfängers. «Eine Ratte ist gegenüber hungrigen Artgenossen viel grosszügiger.» Mit gutem Grund: Auch für sie selbst ist es wichtiger, vor dem Verhungern gerettet zu werden, als auf vollen Magen einen Nachtisch zu erhalten.