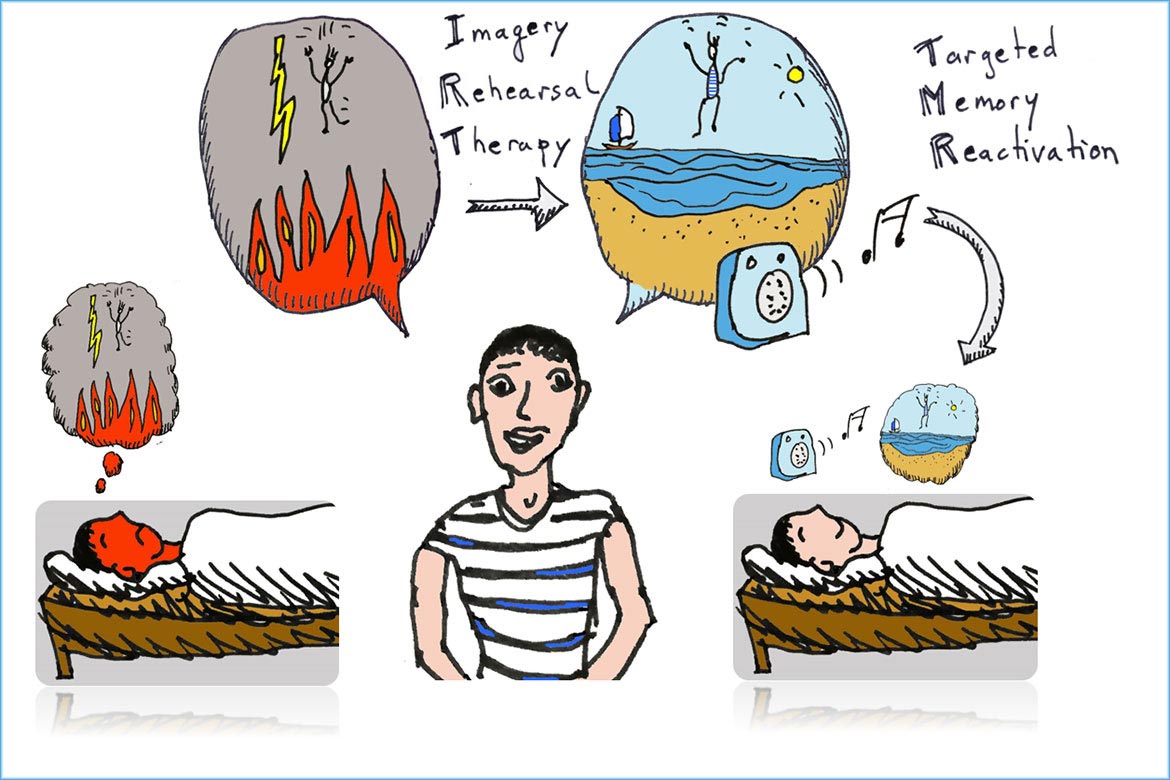ALKOHOLTHERAPIE
Keine Predigt nach Rauschtrinken
Eine Lausanner Forschungsgruppe hat über vier Jahre auf der Notfallstation eine Motivationstherapie gegen Alkoholsucht getestet. Sie soll jungen Trinkenden helfen.

Wegen Besäufnis auf dem Notfall: Eine Therapie für Junge, die auf Moralisieren verzichtet, könnte zu Besserungen führen. | Foto: Marius Eckert
Immer wieder landen junge Erwachsene nach einem Alkoholexzess auf der Notaufnahme, wo sie wegen einer Vergiftung oder eines Unfalls behandelt werden müssen. Alkohol ist gemäss Sucht Schweiz für über zehn Prozent der Todesfälle in diesem Alter verantwortlich. Da sich von den Jungen kaum jemand in Therapie begibt, ist die Notfallstation in den Fokus gerückt. Zurzeit ist dort die motivierende Kurzintervention beliebt. Das ist ein von einer Fachperson durchgeführtes Gespräch ohne Moralpredigt, bei dem mit der Patientin zusammen geschaut wird, ob sie an ihrem Lebenswandel etwas ändern und, wenn ja, welche konkreten Schritte sie unternehmen möchte.
Ob motivierende Kurzinterventionen jedoch wirksam sind und Rauschtrinken tatsächlich reduziert werden kann, dazu widersprechen sich die Befunde gegenwärtig. Es ist nicht einfach, die Wirkung einer derart komplexen Therapieform zu untersuchen. Jacques Gaume vom Lausanner Universitätsspital und sein Team haben sich aber darangemacht und zusammen mit der Notfallstation eine Studie entworfen.
Vergleich mit und ohne Empathie
Die erste Frage, die sich dabei stellte: Womit soll man die neue Intervention vergleichen? «Standardmässig gibt es auf Notfallstationen keine weiterführende Suchtbehandlung», sagt Gaume. «In Lausanne haben wir ein Basismodell mit einer kurzen Beratung und einer Empfehlung für eine spezialisierte Therapie.» Wie es genau ablaufe, sei je nach Arbeitsbelastung anders. Damit ein sinnvoller Vergleich aber möglich ist, musste die Standardbehandlung für die Studie vereinheitlicht werden. Dies erlaubt, einen klaren Unterschied zwischen beiden Interventionen herzustellen. «Dafür mussten wir beim Basismodell aber alles entfernen, was mit Empathie zu tun hat.»
Bei der motivierenden Kurzintervention ist die Empathie hingegen zentral: Zuerst wird eine Beziehung zwischen Therapeutin und Patient aufgebaut. Das Problem soll zusammen erfasst werden, wobei keine Konfrontation entstehen soll. Danach wird darüber gesprochen, wie die Situation besser werden könnte. Und in einem dritten Teil werden möglichst konkret die nächsten Schritte geplant, die der Patient unternehmen möchte. Es gibt eine schriftliche Zusammenfassung für den Patienten, und, falls er dies wünscht, erkundigt sich die Therapeutin nach einer Woche, nach einem Monat und nach drei Monaten telefonisch über seine Situation und deren Entwicklung.
Das ausgeklügelte Gesprächsschema wurde in einer Vorstudie an zehn Patientinnen getestet, optimiert und das genaue Studienprotokoll dann publiziert. Die eigentliche Studie rekrutierte dann insgesamt 344 Patientinnen und teilte sie zufällig in zwei Gruppen ein: Standardkurzberatung ohne Empathie oder motivierende Kurzintervention.
Noch sind nicht alle Daten ausgewertet, das Hauptresultat steht aber schon. «Es funktioniert. Wir konnten die Zahl der Episoden mit Rauschtrinken auf tieferem Niveau stabilisieren», sagt Studienleiter Gaume. Als Rauschtrinken gelten Situationen, in denen mehr als sechs Gläser Alkohol aufs Mal getrunken wurden. Personen mit Standardkurzberatung hatten im ersten Monat nach der Intervention im Durchschnitt 3,4 Epidsoden mit Rauschtrinken, die bis im zwölften Monat aber auf 5,1 anstiegen. Mit der Motivationsbehandlung war der Anstieg deutlich kleiner: von 3,7 Episoden im ersten Monat auf lediglich 4,1 im zwölften. Die neue Behandlung scheint also nachhaltiger zu wirken.
Noch sind die Resultate nicht veröffentlicht. Erik von Elm, Leiter des Schweizer Ablegers der Cochrane Collaboration, die sich für ein evidenzbasiertes Gesundheitssystem einsetzt, lobt jedoch das systematische Vorgehen in dieser Studie. Allerdings «sollte es ja eigentlich schon seit Jahren ein Standard sein», dass die Ergebnisse unabhängig davon publiziert werden, wie sie herauskommen. Wie gründlich die Studie gemacht wurde, zeige sich auch daran, dass sie seit 2016 läuft. Von Elm sagt dazu: «Gut gemachte klinische Forschung braucht ihre Zeit, aber knapp bemessene Förderbeiträge lassen das nicht immer zu – und dann werden eben Abstriche gemacht.»