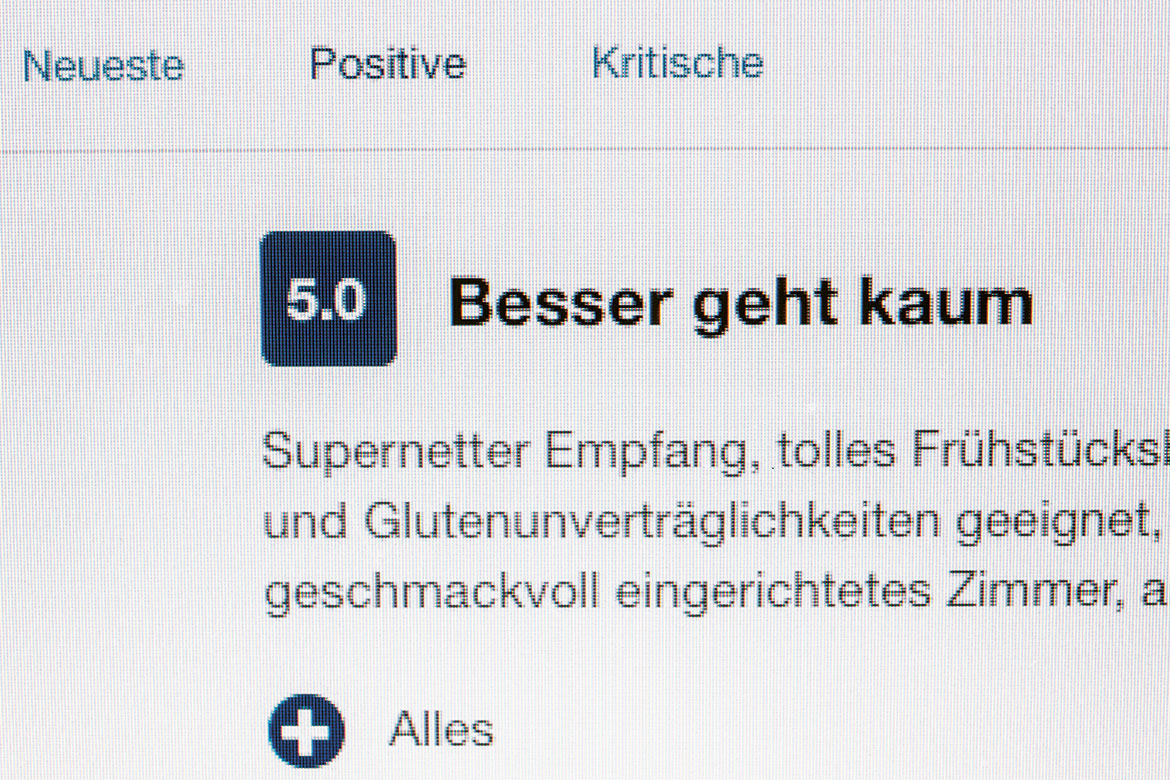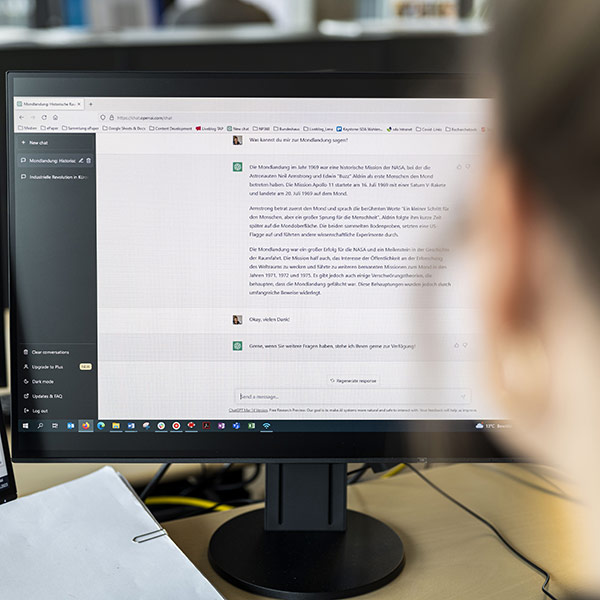Fokus: Publizieren im Umbruch
Fünf kreative Impulse aus der Schweiz
Die Welt der wissenschaftlichen Publikationen wandelt sich, auch dank neuer Ideen von hier. Ein Überblick in fünf Häppchen.
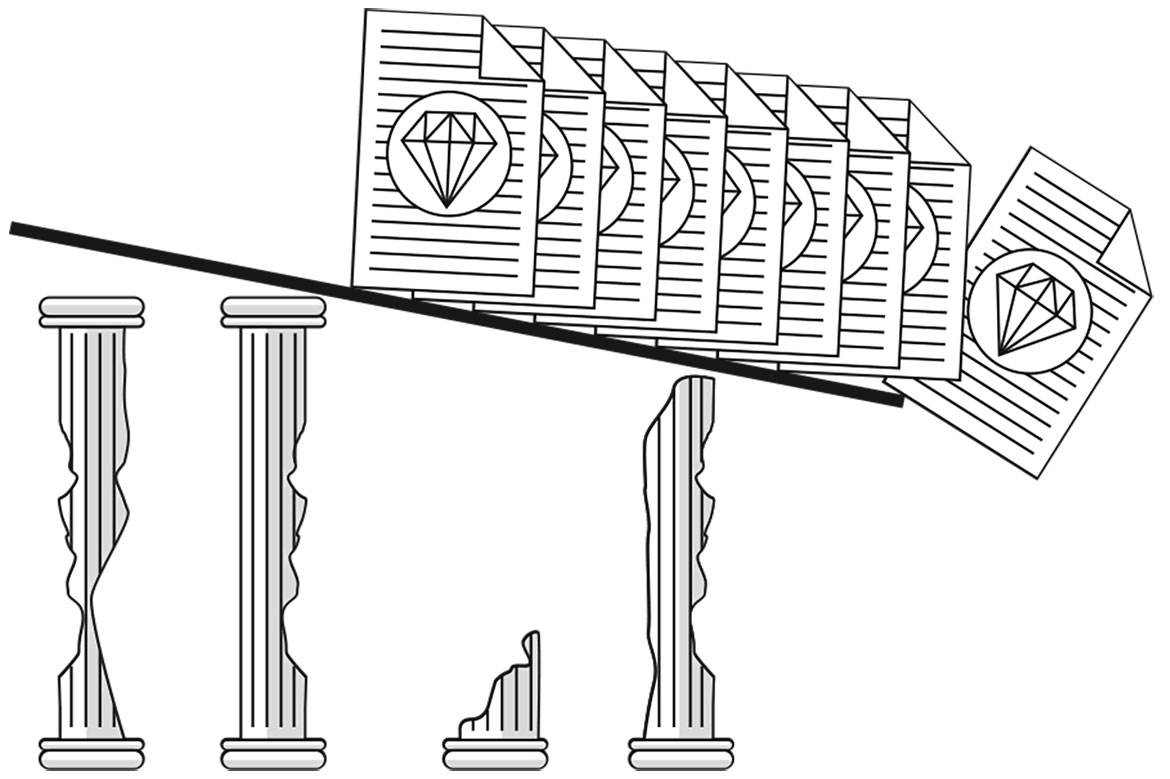
Der Diamond Open Access des Swiss Medical Weekly beruht auf einer Finanzierung durch temporäre Mitglieder. | Illustration: Anna Haas
Weder Abonnements- noch Publikationskosten
Die Swiss Medical Weekly (SMW) orientiert sich mit Stolz am Diamant-Standard des Open Access: Die Zeitschrift ist sowohl für Lesende als auch für Publizierende vollständig kostenlos. Die Autorinnen und Autoren müssen nichts bezahlen, weil «die Einnahmen sonst von der Anzahl publizierter Artikel abhängen, was dazu verleiten könnte, mehr Artikel anzunehmen und bei der Qualität Abstriche zu machen», erklärt Geschäftsführerin Natalie Marty.
Die bekannteste medizinische Fachzeitschrift der Schweiz finanziert sich fast ausschliesslich über die Beiträge der rund zwanzig Mitglieder – hauptsächlich Spitäler und medizinische Vereinigungen wie die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte. Nicht vertreten sind die Hochschulen und die Privatwirtschaft. «Private könnten Zweifel an der Unabhängigkeit der Zeitschrift wecken», meint Marty. Im Spitalumfeld wurde der Nutzen einer medizinischen Zeitschrift, in der die lokale Situation diskutiert und Artikel aus der medizinischen Forschung verfasst werden, rasch erkannt. Zudem sagt Marty: «Unsere Redaktion gibt häufig Feedbacks zur Optimierung von Beiträgen, womit sie zur Ausbildung von jungen Forschenden beiträgt».
Die finanzielle Sicherung der Zeitschrift ist jeweils lediglich auf drei Jahre hinaus geplant, was eine ständige Suche nach neuen Mitgliedern zur Folge hat, «eine Art Startup-Strategie, die langfristig nicht durchzuhalten ist», gibt die Leiterin zu bedenken. SMW-Chefredaktor Adriano Aguzzi vom Universitätsspital Zürich hat seine Vision in Nature 2019 dargelegt: Organisationen, die der Forschungsförderung dienen, wie der Schweizerische Nationalfonds, sollten Zeitschriften unterstützen, die den Diamond Open Access Standard verwenden, und zwar nach einem wettbewerbsorientierten Ansatz. Mögliche Kriterien: Annahmequote eingereichter Artikel, Fristen, Archivierung, Umgang mit zurückgezogenen Artikeln oder auch Innovationen wie Peer-Review nach der Veröffentlichung. Darin zeigen sich im Übrigen die Stärken der SMW: 70 Prozent der eingereichten Artikel werden abgelehnt, Peer-Review-Berichte erscheinen im Durchschnitt innert drei Wochen, und die Archivierung erfolgt über das öffentliche Archiv Clockss, was gewährleistet, dass die Artikel auch zugänglich bleiben, wenn sich die Zeitschrift auflösen sollte.
Die SMW feiert 2021 ihr 150-jähriges Bestehen und scheint – wenn man die Kosten von durchschnittlich 1700 Franken pro publiziertem Artikel sieht – gut zu laufen. Manchmal leisten sich die Herausgeber sogar eine externe Evaluation der Statistiken, die in den Artikeln vorgelegt werden, und eine symbolische Entschädigung von 50 Franken für die Arbeit derjenigen, die den Review machen.
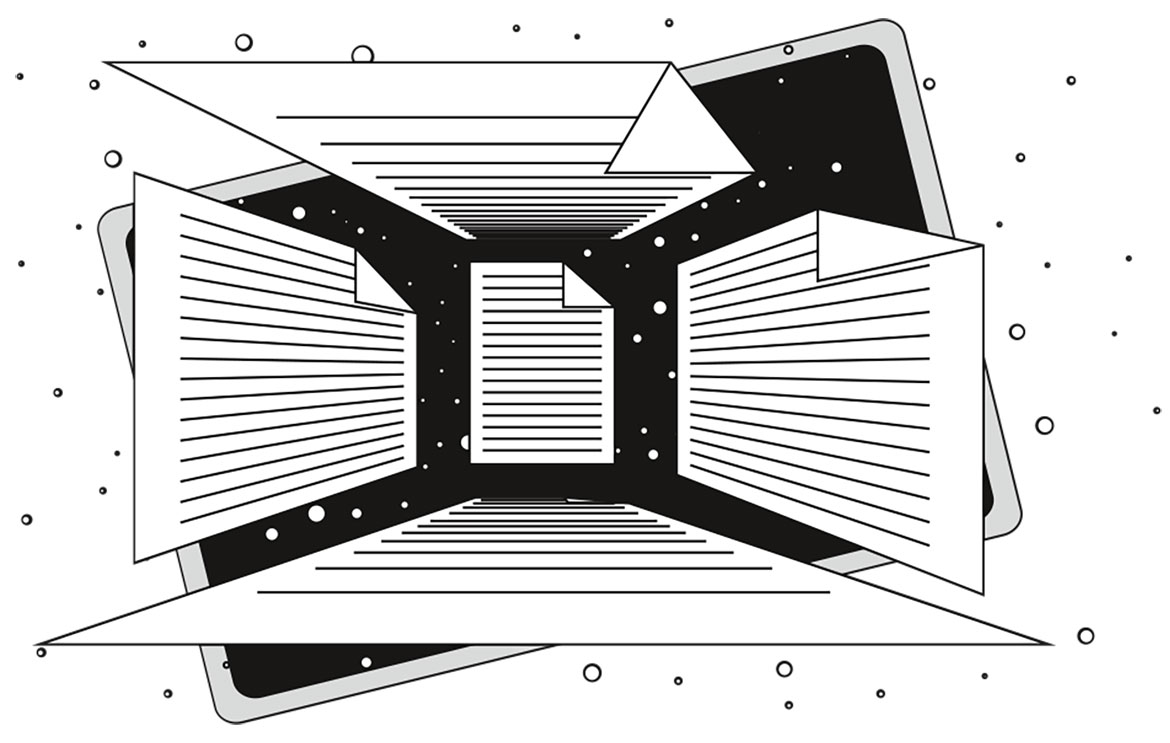
Mit Online-Multimedia-Anthologien für Lyrik können neue Welten entdeckt werden. | Illustration: Anna Haas
Poesie bringt frischen Wind
Digitale Wissenschaftspublikationen begnügen sich häufig damit, Artikel in Form von statischen Texten oder PDFFiles bereitzustellen. Und ein Blick zum Beispiel in die interaktiven akademischen Bücher des Genfer Verlags Metispresses enttäuscht: Nach dem Installieren einer Software, um die Lektüre starten zu können, erscheint ein unlesbarer Text mit durcheinandergeworfenen Zeichen und mangelhafter Interaktivität.
Ein Spezialist für Poesie von der Universität Lausanne will dies ändern. Antonio Rodriguez entwickelt Online-Multimedia-Anthologien für Lyrik. «Die gedruckten Versionen orientieren sich jeweils an einem einzigen Kriterium – die Einteilungen erfolgen etwa nach Thema, Zeitepoche oder Region der Gedichte», erklärt der Forscher. «Unsere digitalen Versionen ermöglichen neue Kombinationen und neue Analysen.» Eine weitere Initiative seines Teams: die Erarbeitung eines interaktiven Wörterbuchs mit 24 Konzepten der Gedichtanalyse, damit diese in verschiedenen Sprachen verglichen werden können.
Doch solche Erfindungen können auf institutionelle Hindernisse stossen, zum Beispiel bei Referenzen auf digitale Inhalte, genannt DOI. Ein anderes Beispiel: Das Team aus Lausanne möchte seine Arbeiten zum Primitivismus in der Poesie in Form eines interaktiven Katalogs veröffentlichen. Doch der Schweizerische Nationalfonds hat diesen Teil des Projektes finanziell nicht unterstützt, erzählt Antonio Rodriguez: Der Forschungsförderer scheine zu befürchten, dass eine unprofessionelle, qualitativ schlechte Plattform entstehen könnte, und verweise auf die traditionellen Verlagshäuser, doch diese «engagieren sich nur zögerlich in solchen interaktiven Projekten».
Innovationen entstehen nur, wenn man ausgetretene Pfade verlässt. «In der Schweiz gibt es gewisse Barrieren, aber auch viel Förderung», ergänzt Antonio Rodriguez. «Schliesslich konnten doch zwei der drei Projekte für interaktive Publikationen meines Teams realisiert werden. Ich sehe uns als Pioniere – aber auch als Versuchskaninchen. Wir entdecken nach und nach Probleme und lösen diese. Dass wir unsere Erfahrungen teilen können, ist wichtig: Unser Ziel ist nicht Innovation als Selbstzweck, sondern wir wollen neue, nachhaltige Ansätze zur Präsentation wissenschaftlicher Erkenntnisse bereitstellen.»
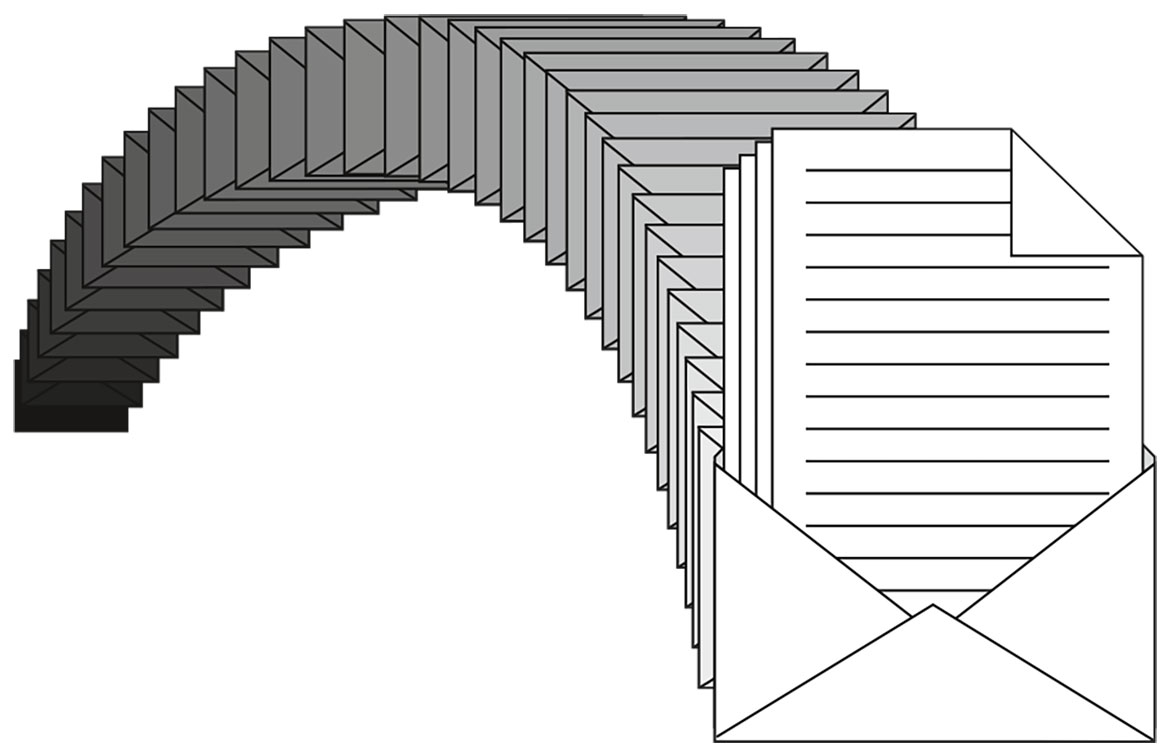
Kommerzielle Open-Access-Verlage generieren ihr Einkommen aus Publikationsgebühren: Quantität ist ein gutes Geschäft. | Illustration: Anna Haas
Kontroverse um junges Schweizer Schwergewicht
Zwei der weltweit grössten Akteure für Open Access befinden sich in der Schweiz: MDPI in Basel mit 166 000 publizierten Artikeln im Jahr 2020 (plus 51 Prozent gegenüber 2019) und Frontiers in Lausanne mit rund 48 000 Artikeln (plus 45 Prozent).
Doch es kam der Verdacht auf, dass MDPI den spektakulären Aufstieg zweifelhaften Praktiken im Stil von Predatory Journals verdankt. Dies jedenfalls fragte Paolo Crosetto in seinem Blog zu Forschungsthemen. Er weist darauf hin, dass das Wachstum von MDPI hauptsächlich den Sonderausgaben zu verdanken ist: Ausgaben mit Artikeln zu einem bestimmten Thema und unter der Leitung von Forschenden aus diesem Fach. 2020 gab die Zeitschrift erstaunliche 100 Sonderausgaben pro Journal heraus, bei der Zeitschrift Sustainability waren es sogar über 3000, gegenüber 24 normalen Ausgaben pro Jahr.
Dass Tausende von Gasteditierenden mittels Massenmails rekrutiert werden, ist eine irritierende Praxis, vor allem wenn diese bei Forschenden landen, die in einer weit entfernten Disziplin arbeiten. Die Gasteditierenden wiederum müssen Kolleginnen und Kollegen überzeugen, Artikel einzureichen, was eine erneute Mail-Lawine auslöst. «Wie jedes digitale Unternehmen verwenden wir E-Mails, um Kunden zu identifizieren und mit ihnen zu kommunizieren», erklärt Stefan Tochev, Kommunikationsverantwortlicher bei MDPI. «Wir wollen Forschende dazu motivieren, in ihrem Netzwerk Diskussionen anzustossen.»
Wissenschaftskommunikator Christos Petrou von Scholarly Intelligence macht in einer Analyse darauf aufmerksam, dass MDPI inzwischen einen besseren Ruf hat und 60 Prozent der eingereichten Artikel ablehnt. Dazu kommt ein unschlagbares Tempo: Eine Publikation entsteht durchschnittlich in weniger als sechs Wochen – für gewisse Autorinnen und Autoren ein wesentlicher Pluspunkt. Online gehen die Meinungen auseinander. Gewisse Stimmen berichten von guten Erfahrungen mit MDPI, andere haben entschieden, nicht mehr an der Evaluation von Artikeln mitzuarbeiten, und kritisieren, dass ein Druck besteht, Artikel anzunehmen. Hier liegt der Kern des Problems: Die kommerziellen Open-Access-Verlage generieren ihr Einkommen aus Publikationsgebühren, die sie pro Artikel verlangen.
Ihre Aktionärinnen – und das Management – haben deshalb ein Interesse daran, möglichst viel zu publizieren. Den kritischen Stimmen zum Trotz: Die beiden Schweizer Unternehmen Frontiers und MDPI liegen auf Rang 3 beziehungsweise Rang 7 der Verlage, deren Artikel am häufigsten zitiert werden – vor Konkurrenten mit makellosem Ruf wie Springer Nature oder Oxford University Press.
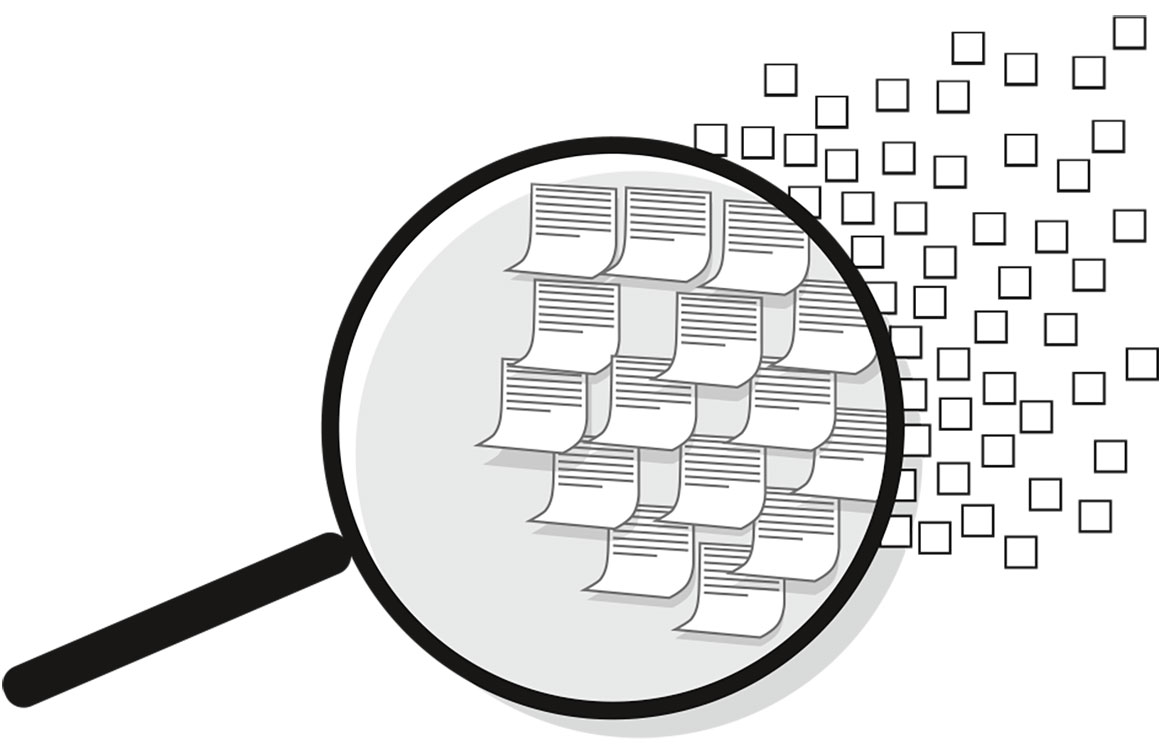
Beobachtung für Beobachtung zu publizieren, hätte die Forschung beschleunigen und ehrlicher machen sollen. | Illustration: Anna Haas
Revolutionäres Start-up gescheitert
Die Idee klingt verführerisch: Die 2016 in Zürich lancierte Zeitschrift Matters publiziert einzelne wissenschaftliche Beobachtungen. Die Forschenden können so ihre Ergebnisse Schritt für Schritt publizieren, ohne dass sie abwarten müssen, bis diese für einen vollen Artikel ausreichen. Das soll die Forschung beschleunigen und die Versuchung verhindern, Erkenntnisse zu schönen. Veröffentlicht werden sollen auch schrittweise, unspektakuläre und negative Ergebnisse. Finanziert wird die Zeitschrift über Publikationsgebühren (150 Franken pro Beobachtung) und jährliche Pauschalbeiträge zwischen 5000 und 50 000 Franken, die einer Hochschule das Recht geben, 50 Artikel zu publizieren.
Der Realitätscheck fällt ernüchternd aus: Im November 2021 funktioniert die Internetseite der Zeitschrift Science- 26 Horizonte 131 matters.io seit zwei Monaten nicht mehr, und E-Mails kommen nicht an. «Wir haben ein Problem mit der automatischen Erneuerung des Domain-Namens der Site», erklärt Geschäftsführer Lawrence Rajendran, ein Neurowissenschaftler, der heute in London lebt. «Das sollte bald gelöst sein.» (Anm. d. Red.: Zwei Monate nach dem Gespräch war es noch nicht gelöst.) Kein banales Problem: Falls die Autorinnen und Autoren ihre Erkenntnisse nicht selber irgendwo archiviert haben, sind die Artikel damit nicht mehr zugänglich. Und das Modell scheint sich nicht durchzusetzen: Lediglich 150 Beobachtungen wurden seit der Lancierung veröffentlicht. «Das ist natürlich zu wenig. Ich habe mit mehr Leuten gesprochen, um das Projekt zu entwickeln», meint der Geschäftsführer lakonisch.
Wie ist dieser Misserfolg zu erklären? «Ich stelle in der akademischen Welt viel Scheinheiligkeit fest», antwortet Rajendran. «Einerseits behaupten die Institutionen, dass sie Open Access fördern und Forschungsdaten teilen wollen. Andererseits ermutigen sie ihre Mitarbeitenden, in renommierten Zeitschriften zu publizieren, weil dies vorteilhaft für ihre Profilierung und die Finanzierung ist. Selbst Leute, die Matters unterstützt haben, reichten kaum Beobachtungen ein, weil sie befürchteten, dass sie später an keinem anderen Ort mehr publizieren können.»
Forschende wiederum, die mit dem Projekt zu tun hatten, kritisieren ein chaotisches Management und dass Projekte falsch priorisiert wurden, wie etwa die Entwicklung eines Blockchain-basierten Systems. Eine akademische Laufbahn zu verfolgen und gleichzeitig ein Start-up zu leiten: War dieses Ansinnen je realistisch? «Ich musste für Matters alles neu erlernen, es war ein riesiges Projekt, für das ich nie ein Salär bezogen habe. Mein Hoffnung war, dass eine grosse Schweizer Institution Matters verwendet, um eine eigene Publikation zu lancieren. Mit etwas Abstand muss ich sagen, dass ich wohl eine Zusammenarbeit mit grossen Verlagen wie Elsevier oder Springer Nature hätte anstreben sollen.»
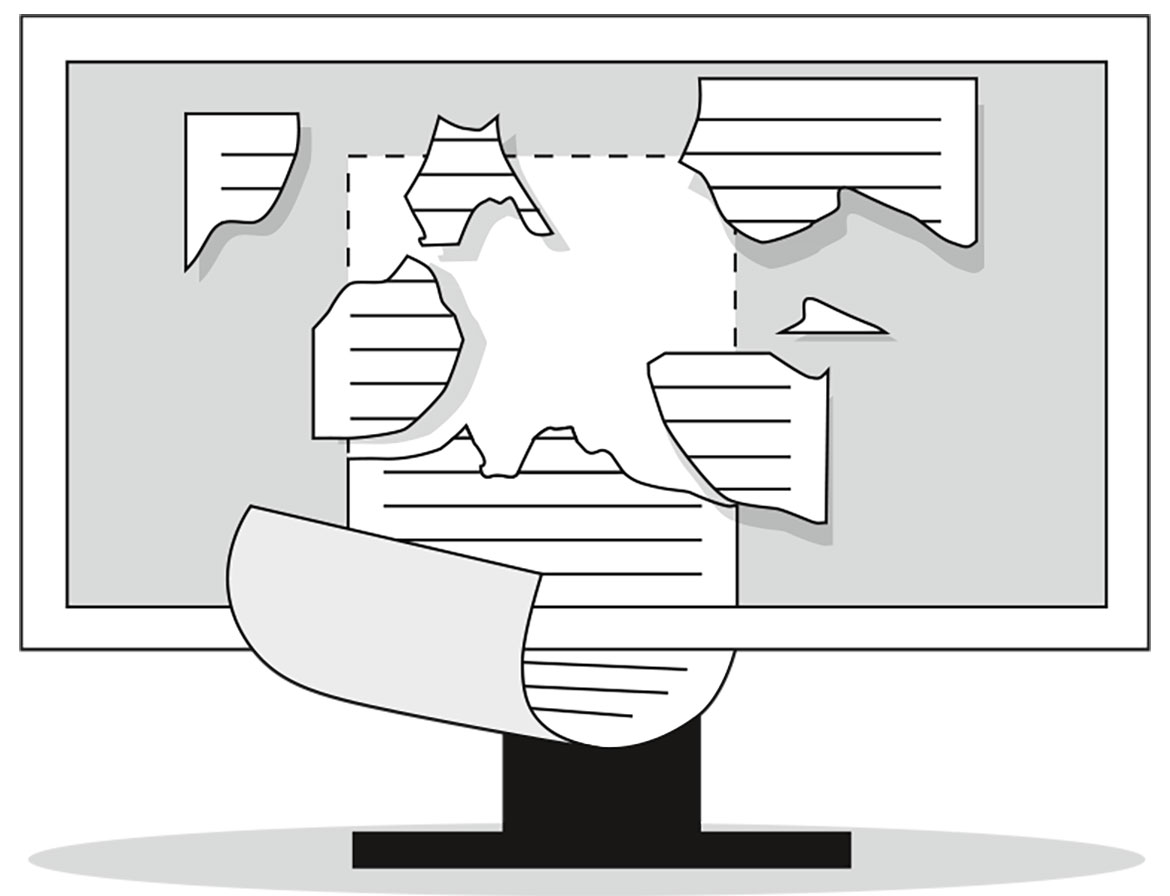
Der Algorithmus kombiniert die Teile der Arbeit bisweilen ehrlicher zu Abstracts als die Forschenden. | Illustration: Anna Haas
Maschine schreibt Abstract
Richard Hahnloser ist Professor für Neuroinformatik an der ETH Zürich und entwickelt intelligente Algorithmen, die beim Schreiben wissenschaftlicher Artikel helfen. «Redigieren ist eine sehr interessante Aufgabe: Man teilt sein Wissen. Doch es kann sehr aufwändig sein, wenn man den richtigen Literaturverweis finden, herunterladen, in sein Literaturverwaltungsprogramm integrieren und vermerken muss. Das bremst die Kreativität. Das ist meine Hauptmotivation für dieses Projekt.»
Sein Team entwickelt einen Texteditor, mit dem man eine Literaturrecherche während des Schreibens durchführen kann. Neben den Schlüsselwörtern, die bei den üblichen Tools verwendet werden, wertet der Prototyp auch Auszüge des gerade redigierten Texts aus: Der Algorithmus klassifiziert nun die bei der Literaturrecherche gefundenen Artikel nach ihrem semantischen Ähnlichkeitsgrad mit der gewählten redigierten Passage.
«Man kann so rasch die richtigen Referenzen finden, ohne mit Kombinationen von Schlüsselwörtern jonglieren zu müssen», erklärt Hahnloser weiter. «Das ist nützlich, wenn man die Einführung eines Artikels schreibt – ein Teil, der sehr viele Verweise auf frühere Arbeiten enthält – oder wenn man einen Forschungsplan zu einem neuen, noch wenig bekannten Bereich erarbeitet und relevante Studien sucht.» Zur Durchführung des semantischen Vergleichs verwendet der Prototyp ein Sprachmodell, das dem bekannten sogenannten GPT-3-Modell gleicht. Es drückt jeden Text mit einem Vektor aus, der auf 256 Parametern beruht. Die Distanz zwischen zwei Vektoren steht dafür, wie ähnlich sich die beiden Texte inhaltlich sind.
Weiter feilt das Forschungsteam an Algorithmen, die wissenschaftliche Artikel zusammenfassen. Damit kann sich eine Forscherin effizient durch die Literatur wühlen, ohne die ganzen Artikel lesen zu müssen. Weshalb nicht einfach das offizielle Abstract der Artikel verwenden? «In den Abstracts wird manchmal eher versucht, Interessierte davon zu überzeugen, dass sie den Artikel lesen, als den Inhalt klar, verständlich und ehrlich zusammenzufassen. Unsere automatischen Zusammenfassungen sind im Allgemeinen genau und informativ. Wir haben unseren eigenen Algorithmus auf den Artikel angewendet, in dem seine Funktionsweise erklärt wird, und ich fand das Ergebnis besser als den Text, den ich selber verfasst hatte. Ich habe leider etwas zu spät realisiert, dass wir unsere automatische Zusammenfassung in der publizierten Version hätten verwenden können!»