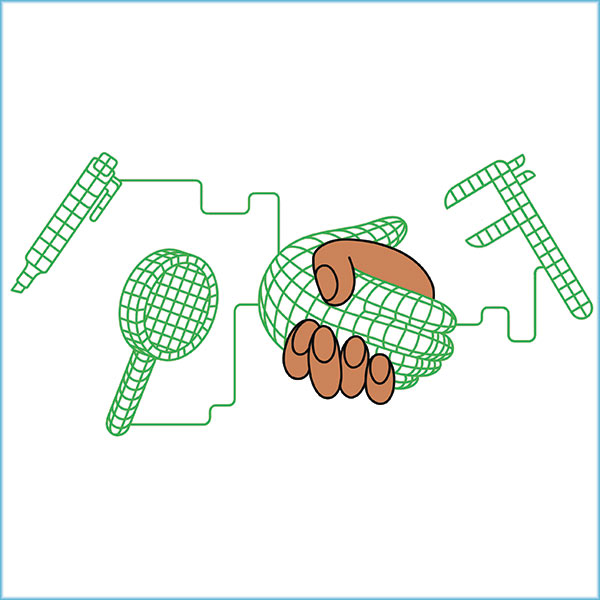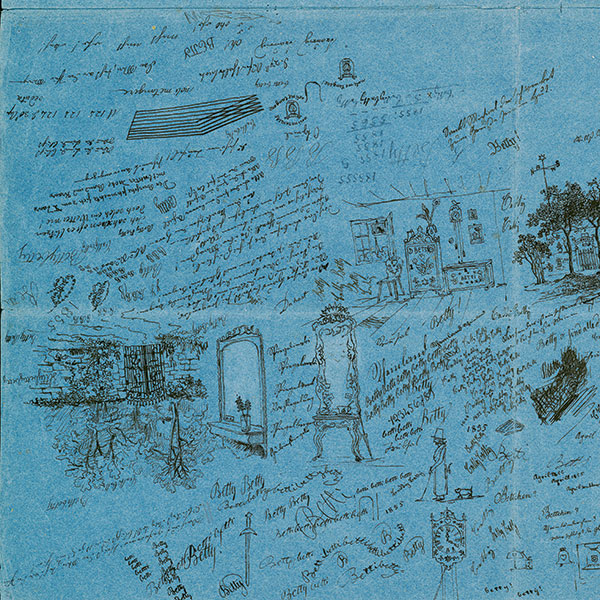Fokus: Publizieren im Umbruch
Was klassische Verlage zu neuen Ideen sagen – oder eben nicht
Horizonte wollte die Rolle der Verlage von Fachpublikationen beleuchten und stiess dabei auf Widerstände. Eine Annäherung in acht Fragen.

Forschende zahlen Geld für die Publikation ihrer Forschungsresultate und hoffen, damit ihr Prestige zu erhöhen und ihre Karriere beschleunigen. | Illustration: Melk Thalmann
Trotz Digitalisierung haben die klassischen Verlage bei wissenschaftlichen Publikationen noch immer die Kontrolle. Nur zum Teil organisieren sich die Forschenden selbst. Damit bestimmen sie auch die Regeln selbst und publizieren ihre Inhalte zum Selbstkostenpreis. Horizonte wollte wissen, was die Verlage von Fachpublikationen und Open-Access-Befürwortende zu solchen Überlegungen sagen – kein leichtes Unterfangen, wie sich herausstellte.
Ein Grossteil der Verlage wollte sich der Debatte gar nicht erst stellen. Manche reagierten nicht einmal auf die Anfrage. Insgesamt haben wir neun Verlage angeschrieben: grosse, traditionelle sowie auch kleine, junge – darunter sechs aus der Schweiz und drei aus dem restlichen Europa. Zwei anfängliche Zusagen wurden zurückgezogen, als unsere Fragen konkret wurden. Am Schluss beantworteten dann doch zwei Verlage mindestens einige unserer Fragen. Zwei Forscher, die im Publikationswesen engagiert sind, komplettieren das Bild.
Weshalb müssen Preprints überhaupt noch in einer offiziellen Fachzeitschrift veröffentlicht werden?
Vorabpublikationen sind in der Wissenschaft seit Längerem Trend – und dieser verstärkte sich in der Corona-Pandemie noch. Es kam mehr denn je auf die Geschwindigkeit an, und so wurden auf einmal fast alle Arbeiten zum Thema auf sogenannten Preprint-Servern abgelegt, bevor sie später in klassischen Fachpublikationen erschienen.
Der Publikationsprozess wurde damit zwar transparenter, doch Matthias Barton, Medizinprofessor an der Universität Zürich und leitender Redaktor der britischen Open-Access-Fachzeitschrift E-Life, ist skeptisch: Preprints seien lediglich nicht begutachtete Zusammenfassungen von wissenschaftlichen Arbeiten. Beim Thema Covid-19 seien solche Manuskripte in den Medien zitiert worden, ohne dass dies klargemacht wurde. Fachzeitschriften hingegen würden schlechte Manuskripte ablehnen. Ähnlich sieht es Kerstin Mork, Senior Communications Managerin der Springer Nature Group in Berlin: «Da es bei Preprints keinen Peer-Review gibt, ist nicht sichergestellt, ob sie einer objektiven Begutachtung standhalten.» Die Verlage garantieren jedoch die Begutachtung und liefern damit einen Bezugspunkt für weitere wissenschaftliche Arbeiten.
Aber der klassische Peer-Review stellte sich immer wieder als unzureichend heraus. Wie werden denn die schlechten Publikationen abgesondert?
Seit Dezember 2020 müssen zum Beispiel bei der Fachzeitschrift E-Life alle eingereichten Arbeiten bereits als Preprint-Manuskript im Internet verfügbar sein. So finde schon ein erster Peer-Review vor der eigentlichen Publikation statt, erklärt der leitende Redaktor Matthias Barton. Den organisierten Peer-Review beim Einreichen brauche es aber trotzdem. So würden schlechte Arbeiten verhindert. Das gehe so: Wenn ein Manuskript von der Redaktorin angenommen wird, geht es an ein Mitglied des Editorial Board mit thematischer Fachkenntnis, das Gutachten von externen Expertinnen und Experten einhole. Dann gingen die Arbeiten an die Schreibenden zur Nachbearbeitung zurück, ehe sie publiziert würden. Diese Nachbearbeitung wirke sich positiv auf die Qualität des Artikels aus.
Sollen die Fachleute im Peer-Review auch Fehlverhalten aufdecken?
Immer wieder werden nicht erkannte Manipulationen als Fehler des Begutachtungssystems betrachtet. Der Wissenschaftsjournalist Ralf Neumann von der deutschen Zeitschrift Laborjournal findet diesen Vorwurf ungerecht und schreibt in einem Kommentar: «Begutachtende haben idealerweise die Aufgabe, die Arbeiten der Kollegen zwar kritisch, aber möglichst wohlwollend zu beurteilen – und nicht jeden Autor von Vornherein des potenziellen Betrugs zu verdächtigen.»
Beschwerden gegen bereits veröffentlichte Artikel oder Manuskripte werden jeweils von der Redaktion geprüft. «Erforderlichenfalls werden andere Personen und Institutionen konsultiert, darunter Universitätsbehörden oder Sachverständige auf dem Gebiet», erklärt Stefan Tochev, Marketing und Communications Manager bei MDPI, einem 1996 in Basel gegründeten Open-Access-Verlag. Ähnlich klingt es auch bei Springer Nature: Geprüft wird im Nachhinein.
Verlage würden die Texte zwar auf Fälschungen prüfen, sagt der Mediziner Matthias Barton, sie seien inhaltlich aber nicht selbst in der Lage dazu und müssten Forschende damit beauftragen. «Das Problem ist häufig, dass es für Spezialbereiche, etwa in der Medizin, je nach wissenschaftlichem Teilgebiet nur wenige wirklich ausgewiesene Fachleute gibt», erklärt er. «In der Medizin können falsche Daten im schlimmsten Fall Menschenleben kosten.» Gegenwärtig könne man jedoch fast alles publizieren, solange man die Publikation bezahle. Er plädiert deshalb für eine unabhängige Untersuchungsstelle, die mögliche Verfehlungen überprüfe und gegebenenfalls sanktioniere – in der Art des Office of Research Integrity in den USA.
Wäre es nicht ehrlicher, wenn die Begutachtung nach der Publikation gemacht würde, sodass es nicht zu Zensur oder Vetternwirtschaft kommt?
Einem Freund wird zur Publikation verholfen, eine Konkurrentin wird hinter verschlossenen Türen ausgebremst oder die Veröffentlichung wird mit Geld erkauft: Solche Geschichten gibt es viele. Wenn die Qualität nach der Publikation ermittelt würde, könnte man dem vielleicht Einhalt gebieten. Doch hier winkt die Kommunikatorin von Springer Nature ab. Der Peer-Review vor der Publikation diene der objektiven Begutachtung eines wissenschaftlichen Artikels. Nach erfolgreichem Peer-Review und der Veröffentlichung sei er als finalisierte «version of record» fortan eine mögliche Basis für weitere Arbeiten. Würde der Peer-Review erst nach der Veröffentlichung erfolgen, bestünde die Gefahr, dass fehlerhafte Ergebnisse in weitere Arbeiten einflössen und sich multiplizierten.
Wäre ein Peer-Review auch für Bücher sinnvoll?
«Der SNF verlangt schon heute für Bücher einen Peer-Review, was sinnvoll ist», sagt Daniel Hürlimann, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität St. Gallen und Mitgründer des juristischen Open-Access-Buchverlags Sui Generis. In Disziplinen, die bis vor Kurzem keinen Peer- Review kannten, wie etwa in der Rechtswissenschaft, laufe noch ein Lernprozess.
Sollten Bücher grundsätzlich digital publiziert werden?
Springer Nature publiziert laut Kerstin Mork seit 2005 alle Bücher digital, sie könnten aber auch als Print bestellt werden. Rechtswissenschaftler Daniel Hürlimann meint, dass wissenschaftliche Bücher digital publiziert werden sollen. Viele Lesenden schätzten aber physische Bücher. Am besten sei daher die Publikation in beiden Formen. Der Druck sei nur eine kleine Kostenposition. Mit der Open-Access- Förderung von Büchern durch den Nationalfonds könnten die Kosten für das Korrektorat, den Satz und sogar für ein sogenanntes Enriched E-Book gedeckt werden, bei dem zusätzliche Funktionalitäten wie die Einbettung von Audiound Videodateien oder die Verlinkung zu externen Webseiten verfügbar sind.
Könnte man Artikel und Bücher laufend dynamisch dem aktuellen Wissensstand anpassen?
Das Modell ist durch Wikipedia bekannt. Schreibende passen den Wissensstand regelmässig an, wobei sich die Änderungen nachverfolgen lassen. Matthias Barton von E-Life findet das Modell sinnvoll, aber nur mit einer Qualitätskontrolle durch Leute mit ausgewiesener Expertise. Ein gutes Beispiel sei die Plattform Uptodate.com, ein Online- Medizin-Nachschlagewerk von und für Ärztinnen und Ärzte. Sui-Generis-Mitgründer Daniel Hürlimann hält es beim wissenschaftlichen Arbeiten für zentral, dass eine zitierte Quelle beständig ist. Das schliesse aber dynamisch anpassbare Formen des Publizierens nicht aus. «Es muss nur gewährleistet sein, dass eine bestimmte Version einer Quelle zitier- und abrufbar ist.»
Wie viel darf eine Publikation kosten?
Die Vertreter von MDPI und Springer Nature gingen nicht auf diese Frage ein. Die Fachzeitschrift Nature verlangt für eine Open-Access-Publikation rund 10 000 Franken.
Solche Beträge erachtet Mediziner Matthias Barton als ethisch nicht haltbar, insbesondere wenn man bedenke, wie wenig manche Artikel gelesen würden. Idealerweise sollte das Publizieren gratis sein. Aber man könne sagen: Es sollte so wenig kosten wie möglich und so viel wie nötig. «Es braucht ein Modell, das weggeht von Privatfirmen mit ihrem Business und zurückführt zu den Forschenden, die validiertes neues Wissen weitergeben.»