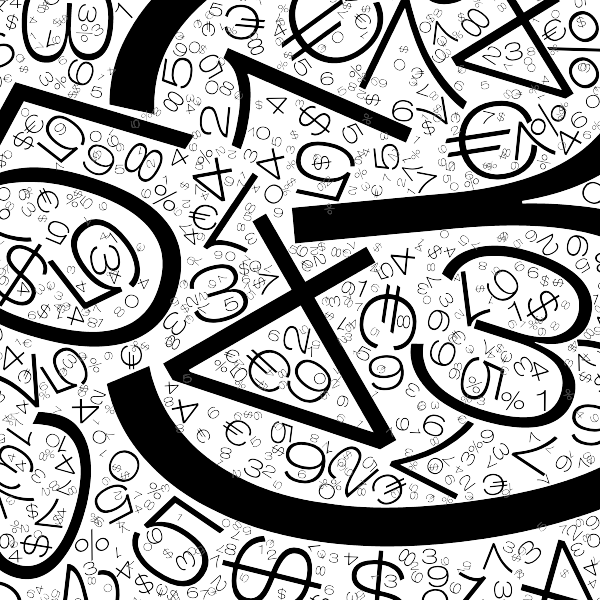Fokus: Die bessere Stadt
Vom grossen Stadt-Land-Graben, der vielleicht so gross gar nicht ist
In der Schweiz wird gern ein Gegensatz zwischen urbanen und konservativen Lebenshaltungen beschworen. Wie viel ist da dran? Eine Spurensuche.

Autofreies Quartier mit urbanem Charme, umgeben von Bergen. In Uptown Mels fliessen Ideale von Stadt und Land ineinander. | Bild: Michel Bonvin
Seit den 1990er-Jahren taucht er immer wieder auf, der Stadt-Land-Gegensatz – mit Vorliebe an Abstimmungssonntagen. «Der Graben wird immer tiefer», sagte Michael Hermann, Politgeograf und Leiter der Forschungsstelle Sotomo, Mitte Juni 2021 in den Medien, nachdem das Schweizer Stimmvolk das CO2-Gesetz verworfen hatte. Die grossen Städte hätten die Vorlage klar angenommen, die Landregionen waren mehrheitlich dagegen: ein typisches Muster für knappe Abstimmungsausgänge in den letzten 30 Jahren, mit Siegen für beide Seiten.
Hermann beschäftigt sich seit 20 Jahren mit dem politischen Stadt-Land-Graben. Der von Sotomo aufgrund nationaler Abstimmungsergebnisse errechnete Wandel zwischen 1990 und 2018 zeigt ein räumliches Muster: Mit Ausnahme von Lugano bewegten sich die grossen Kernstädte nach links, am auffälligsten Bern, das sich vom eingemitteten Verwaltungszentrum zur am weitesten links stehenden Grossstadt der Schweiz verschob.
Driften die Pole auseiander oder rücken sie zusammen?
Schon die angrenzenden Agglomerationen veränderten sich deutlich weniger, während der ländliche Raum bürgerlich-konservativ blieb. Im Dezember 2021 diagnostizierte Sotomo in einer neuen Studie eine «massive Ausweitung des politischen Stadt-Land-Gegensatzes». Bei 14 der 22 nationalen Volksabstimmungen der laufenden Legislatur habe sich eine Differenz zwischen Grossstädten und Land geöffnet, die «weit über dem langjährigen Schnitt» liege.
Markus Freitag, Professor für politische Soziologie an der Universität Bern, bestätigt, dass Umfragen der letzten Jahrzehnte in der Schweiz bei den Einstellungen klar identifizierbare Unterschiede zwischen Land und Stadt ausweisen – wobei nach seiner Einschätzung die beiden Pole weder näher rücken noch auseinanderdriften. Grundsätzlich stehen die Menschen in der Stadt laut diesen Befragungen etwa dem Wohlfahrtsstaat, der Abschaffung der Armee, einer politischen Öffnung oder Wildtieren eher positiv gegenüber, auf dem Land eher ablehnend.
Auffällig ist die Haltung gegenüber dem Auto, das auf dem Land positiv, in der Stadt aber negativ gesehen wird. Genau umgekehrt verhält es sich mit dem Wolf: Für Städterinnen und Städter ist er Teil der Naturromantik, auf dem Land wird er als Problem wahrgenommen. «Was das Auto auf dem Land, ist der Wolf in der Stadt», bilanziert Freitag.
Seine Gruppe beteiligt sich mit Teams der Universitäten Barcelona, Grenoble, Glasgow und Frankfurt seit Anfang 2021 am dreijährigen EU-Forschungsprojekt «Rural-Urban Divide in Europe» (Rude). Erforscht wird unter anderem, wie sich der Stadt-Land-Graben angesichts der Globalisierung auf politische und soziale Überzeugungen auswirkt. In der Schweiz sei die Schere im Vergleich zu anderen Ländern bei Fragen zur politischen Öffnung besonders gut sichtbar.
Allerdings würden die politisch-ökonomischen Strukturen den Konflikt entschärfen: Die kurzen Distanzen, staatliche Instrumente wie der Finanzausgleich oder das Bildungssystem verhindern, dass abgelegene Gebiete wirtschaftlich abgehängt werden. Kein Vergleich etwa zu den USA mit den beiden scharf konkurrierenden politischen Parteien, die den Gegensatz von Stadt und Land aktiv bespielen, oder zu Frankreich mit dem auf Paris fokussierten Zentralismus, der die Unterschiede zuspitzt.
Zu bedenken gibt Freitag, dass in der Schweiz je nach Definition fast vier Millionen Menschen oder 45 Prozent der Bevölkerung in der Agglomeration leben, dass dieser heterogene Zwischenbereich aber wenig erforscht sei. Hoch spannend findet er die Frage, warum sich die Einstellungen von Menschen, die in der genau gleichen baulich durchurbanisierten Agglomeration leben, trotzdem entlang einem Stadt-Land-Muster unterscheiden können. «Erstaunlicherweise wird das Gefühl, kein Städter oder keine Städterin zu sein, oft schon nahe der Stadtgrenzen ausgedrückt.» Doch was genau diese Übergänge in den Agglomerationen markiert, hat die Forschung bis jetzt nicht identifiziert.
Widerstand gegen Veränderungen
Wo endet überhaupt die Stadt und wo beginnt das Land? Statistisch ist klar: Es gibt rund 170 Städte in der Schweiz. Das Bundesamt für Statistik definiert sie als «zusammenhängende Kernzone mit hoher Einwohner- und Arbeitsplatzdichte und mindestens 12 000 EBL», gemeint ist mit Letzterem die Summe aus Einwohnerinnen und Einwohnern, Beschäftigten und bei Tourismusorten einer Logiernächteziffer. Die Liste beginnt bei Zürich, umfasst aber etwa auch Buchs SG, Zermatt oder Ecublens VD.
Die Forschung hingegen definiert Stadt als Kombination mehrerer Ebenen: Physisch ist eine Stadt geprägt durch dichte Bebauung und zentrale Funktionen. Es gibt aber auch eine soziale und eine symbolische Ebene, die Stadt als Ort spezifischer Erlebnisse, Optionen, Konflikte und Begegnungen verstehen – zum Beispiel mit ausländischen Communities, Pop-up-Restaurants oder Hausbesetzungen. Das kann man als Urbanität bezeichnen.
Auf dieser Basis sieht David Kaufmann, Assistenzprofessor für Raumentwicklung und Stadtpolitik sowie stellvertretender Leiter des Netzwerks Stadt und Landschaft an der ETH Zürich, ein Charakteristikum: Die Schweiz sei «grossflächig, aber nicht sehr intensiv urbanisiert ». Es gebe keine riesigen Grossstädte, aber «viele punktuelle Urbanisierungsprozesse, die sowohl in den Zentren als auch in den Agglomerationen intensiv sein können».
Kaufmann befasst sich mit der Akzeptanz von Verdichtung. Ist der häufige Widerstand der Bevölkerung gegen bauliche Verdichtung ein Ausdruck davon, dass man in der Stadt Dörflichkeit erhalten will? Das habe eher mit einer allgemeinen Skepsis gegenüber baulichem Wandel zu tun, entgegnet Kaufmann. Der Zusammenhang sei komplex: Positive Effekte von Verdichtung – weniger Zersiedlung – zeigten sich langfristig und grossräumig, die bauliche Veränderung hingegen betreffe die Leute vor Ort, kurzfristig und direkt.
Warum die urbanen Zonen der Schweiz wenig verdichtet seien, begründet Vincent Kaufmann, Professor für Stadtsoziologie und Mobilität an der EPFL, mit einer Metapher: «Wo es ein physisches Hindernis gibt, bauen wir in der Schweiz gerne einen Tunnel.» Was er damit ausdrückt: Der kontinuierliche Ausbau der Mobilitätsinfrastruktur habe die Schweiz aufgemischt zu einem Land von Pendelnden mit einer flächendeckenden Stadtlandschaft zwischen Genf und Romanshorn.
Neun von zehn Arbeitsplätzen befänden sich heute in den urbanen Zentren, anderseits greifen urbane Lebensstile bis in die hintersten Winkel aus. «Eigentlich», sagt er, «erleben wir eine Art gegenseitigen Kolonialisierungsprozess.» Es sei kein Problem, in einem Dorf im Jura zu wohnen und im Zentrum von Genf zu arbeiten – erst recht, seit die Pandemie die Akzeptanz von Homeoffice erhöht habe. Offen bleibe die Frage, was das für die Verwurzelung der Menschen bedeute.
«Ich halte den Stadt-Land-Gegensatz für überholt», knüpft Heike Mayer an, Professorin für Wirtschaftsgeografie an der Universität Bern. «In Tat und Wahrheit liegen die Extreme räumlich nahe beieinander.» Man finde in peripheren Regionen wie dem Unterengadin oder dem Emmental dynamische Unternehmen, die für den Weltmarkt produzieren, umgekehrt gebe es im urbanen Gebiet Zonen des vorübergehenden Stillstands – etwa auf Industriebrachen am Stadtrand.
Interessante Fingerzeige entnimmt Mayer der Arbeit eines ihrer Doktoranden, der sich mit multilokalen Arbeitsformen beschäftigt. Er begleitete Personen, die ihre Arbeitswoche auf Bürotage in der Stadt und Homeoffice im Berggebiet verteilen. Das gefundene Muster: In der Stadt wickelten die Leute den kreativen, begegnungsreichen Teil ihrer Arbeit ab, in den Bergen denjenigen Teil, der Konzentration und Ungestörtheit erfordert. Auch das sei ein Hinweis, findet Mayer, dass «wir mehr Energie darauf verwenden sollten, Stadt und Land nicht als Gegensatz, sondern als sich ergänzendes System zu verstehen».
Kein Zweifel: Der Graben zwischen Stadt und Land existiert in den Köpfen und drückt sich mitunter in Abstimmungsresultaten aus. Aber: Im Alltagsleben der meisten Schweizerinnen und Schweizer fliessen beide ineinander, sodass sie kaum auseinanderzuhalten sind.