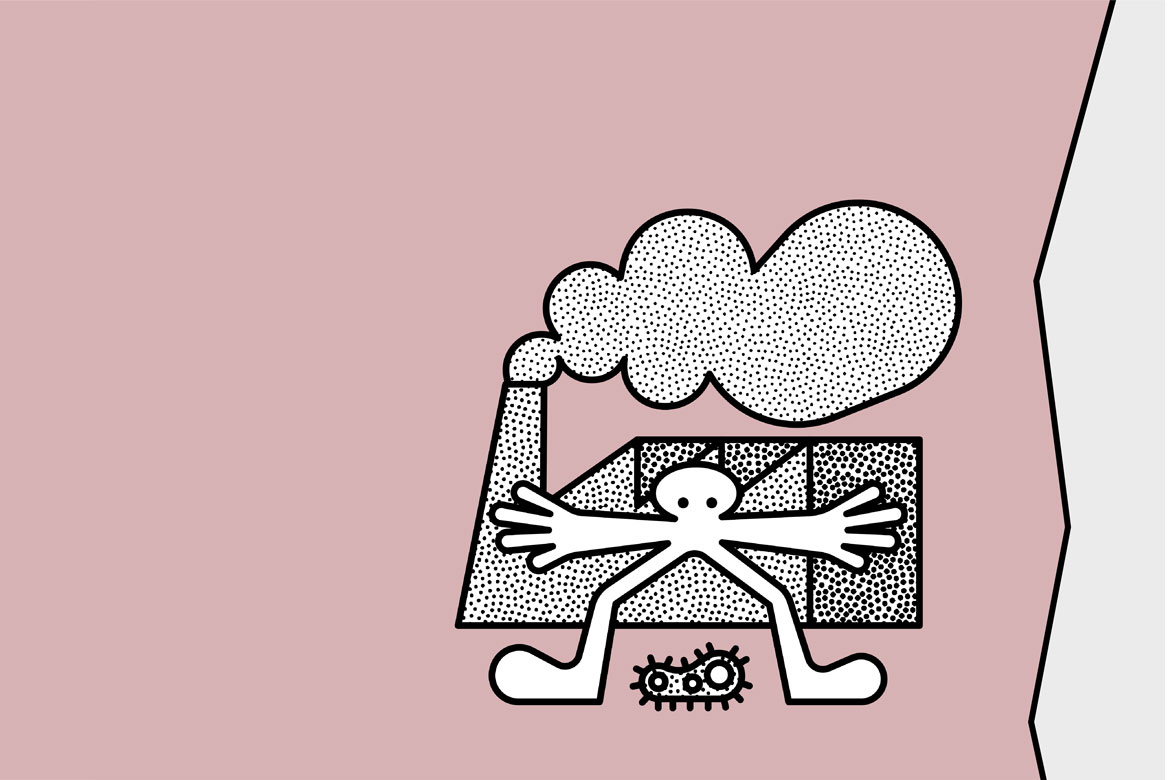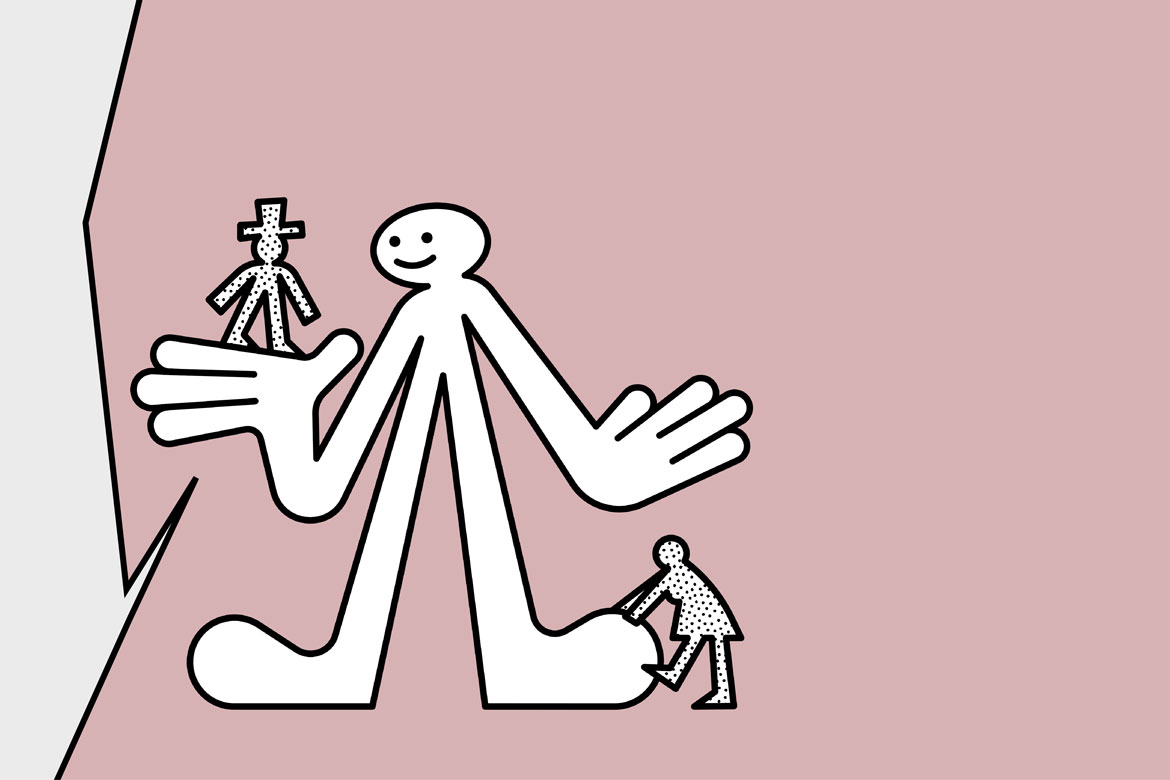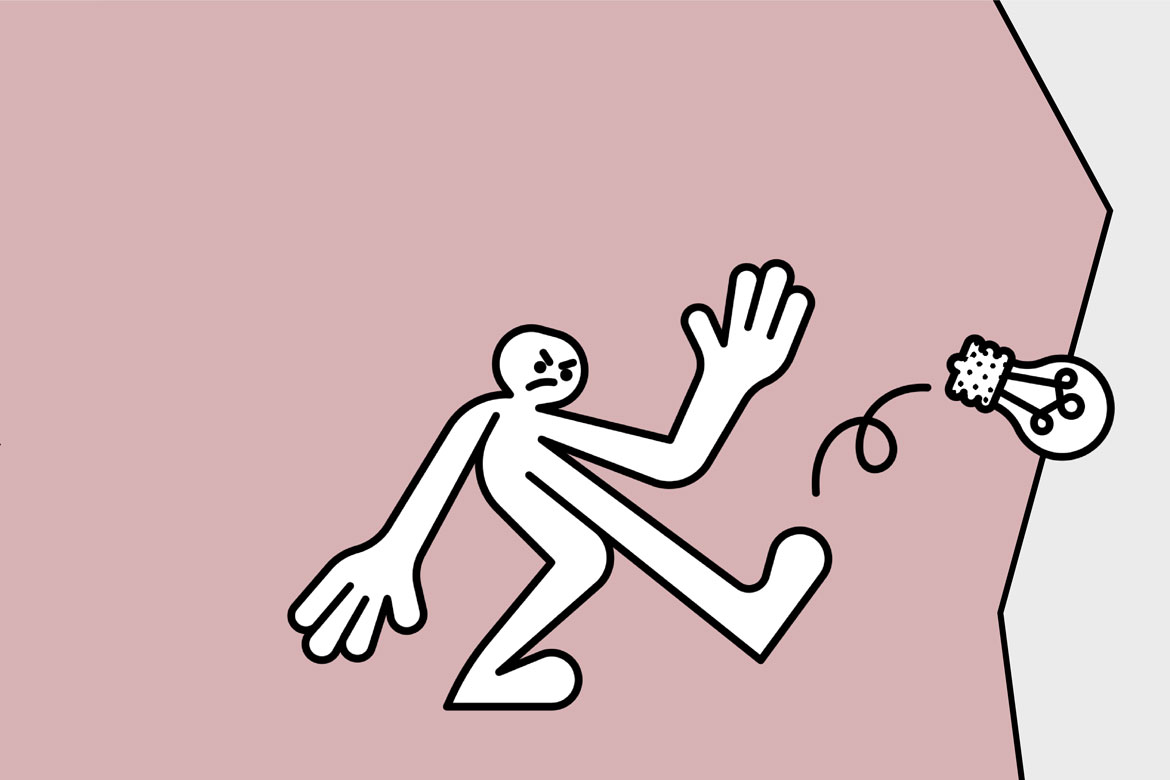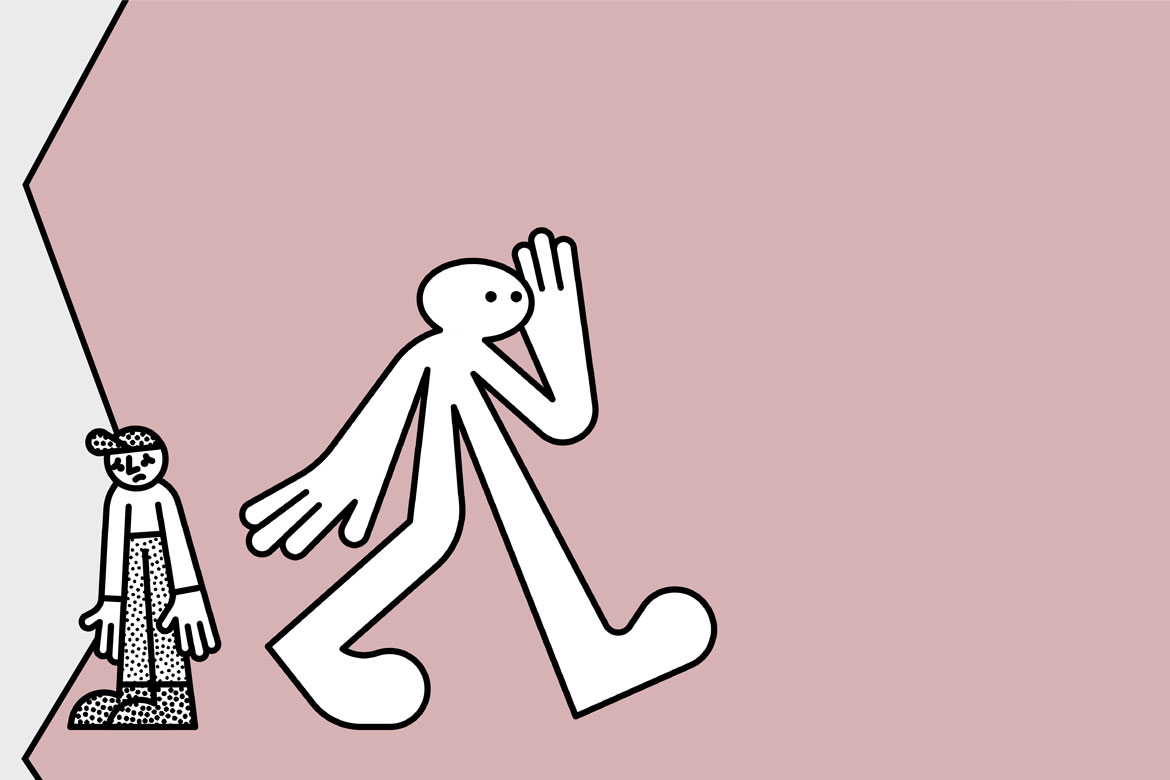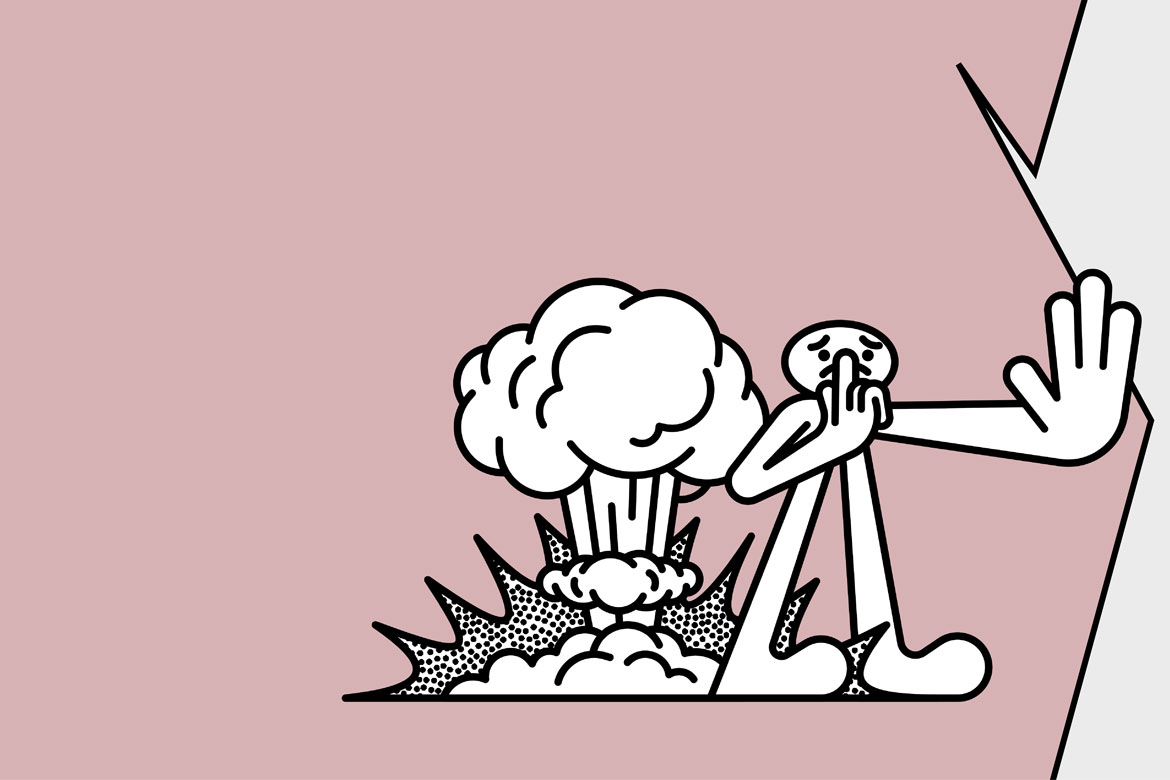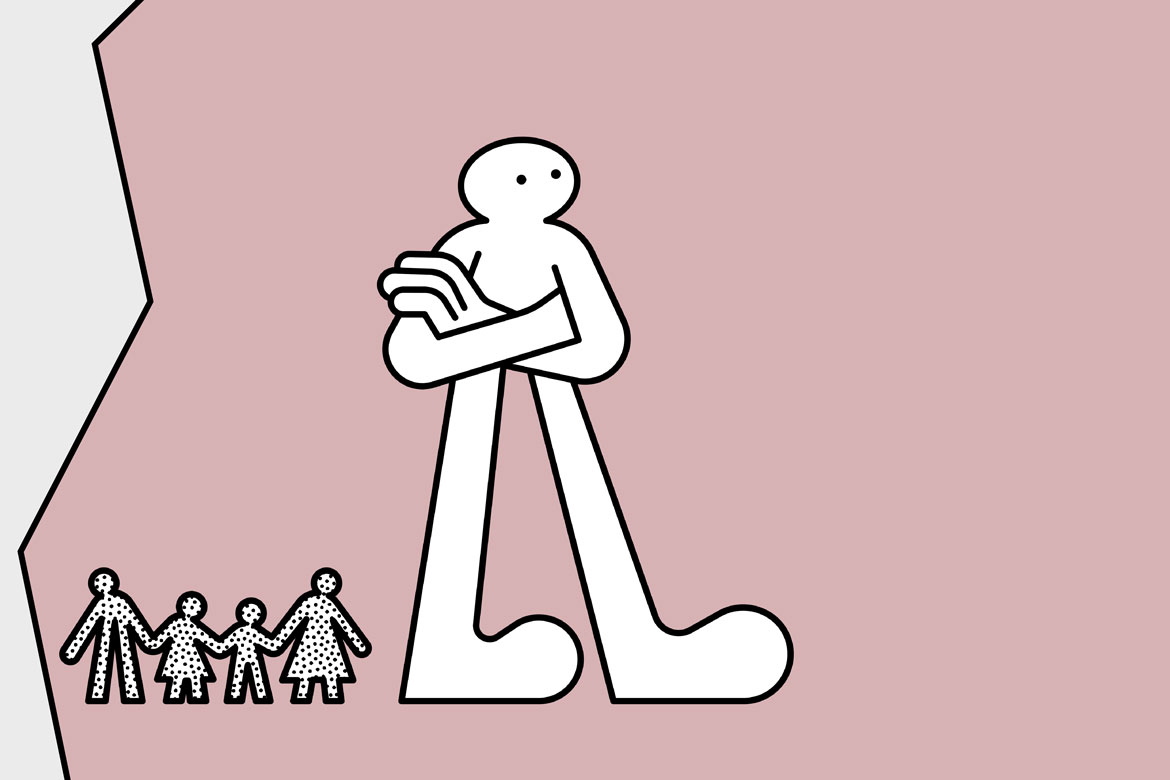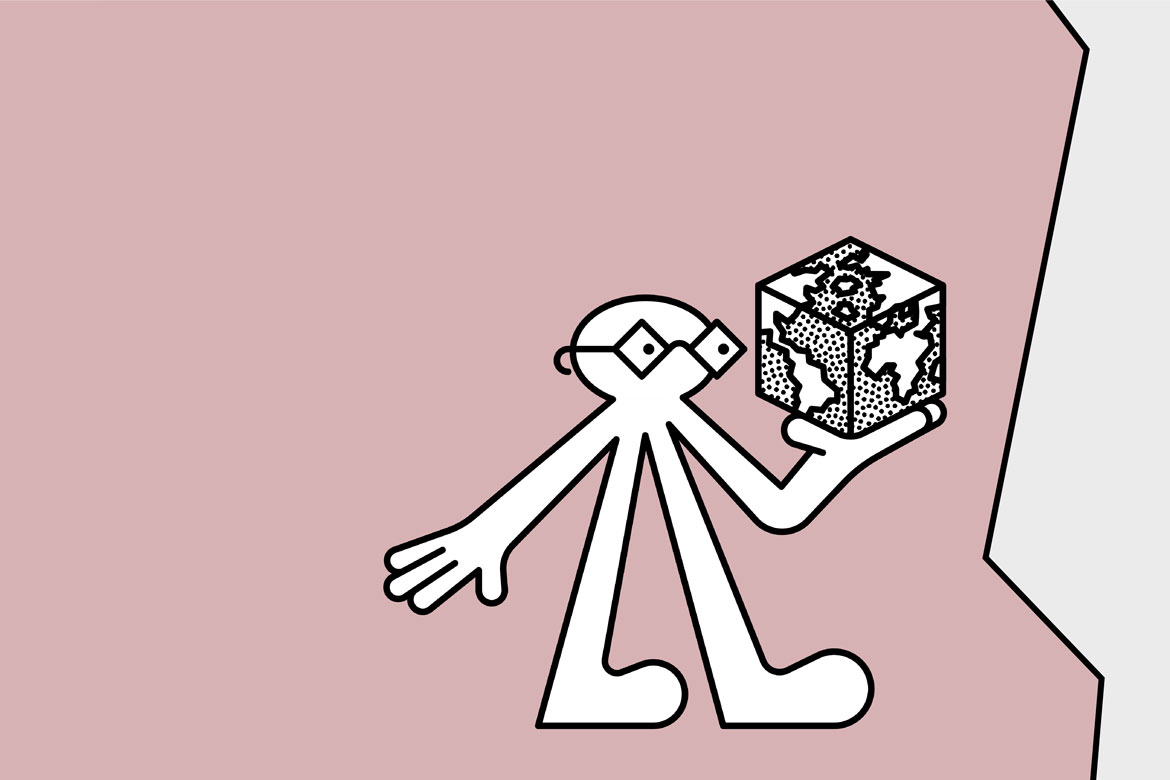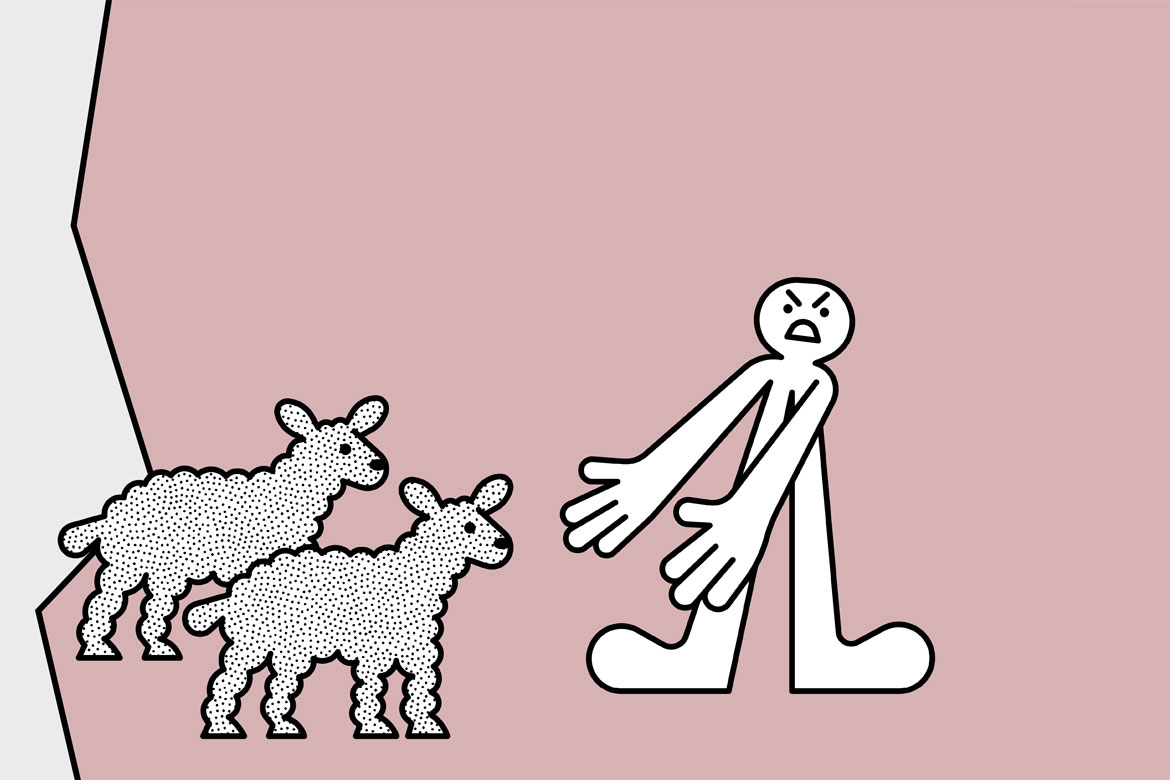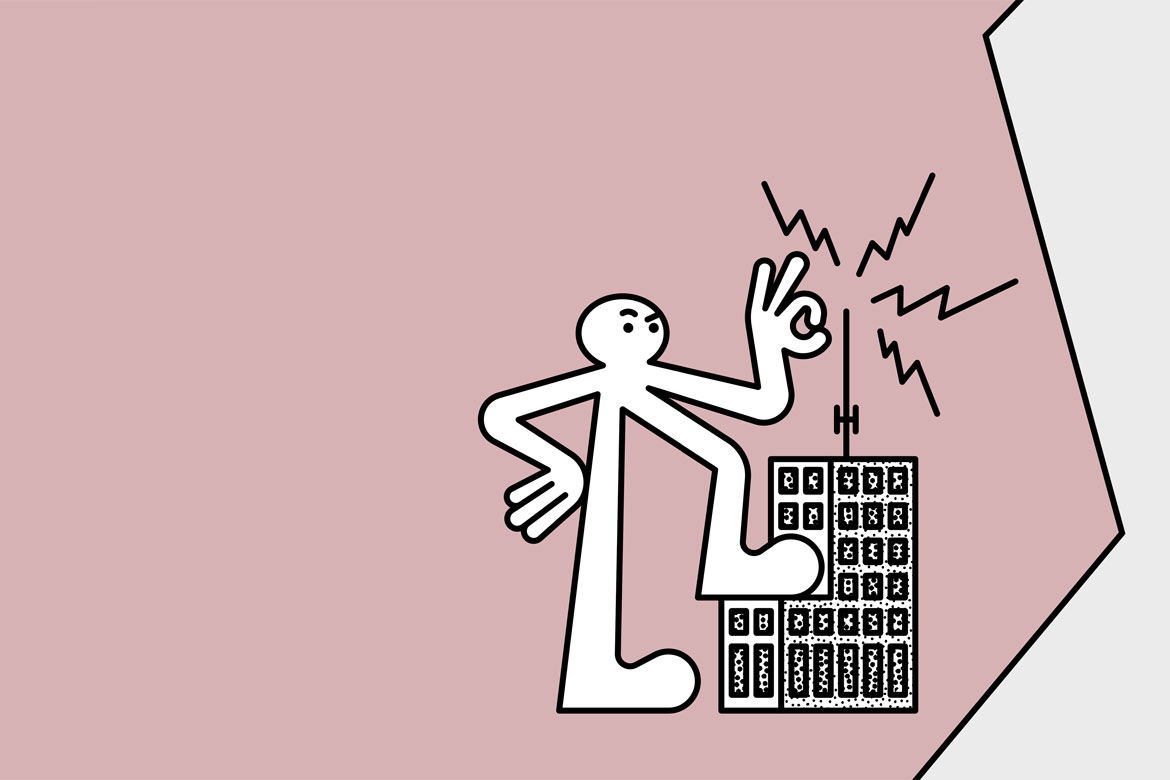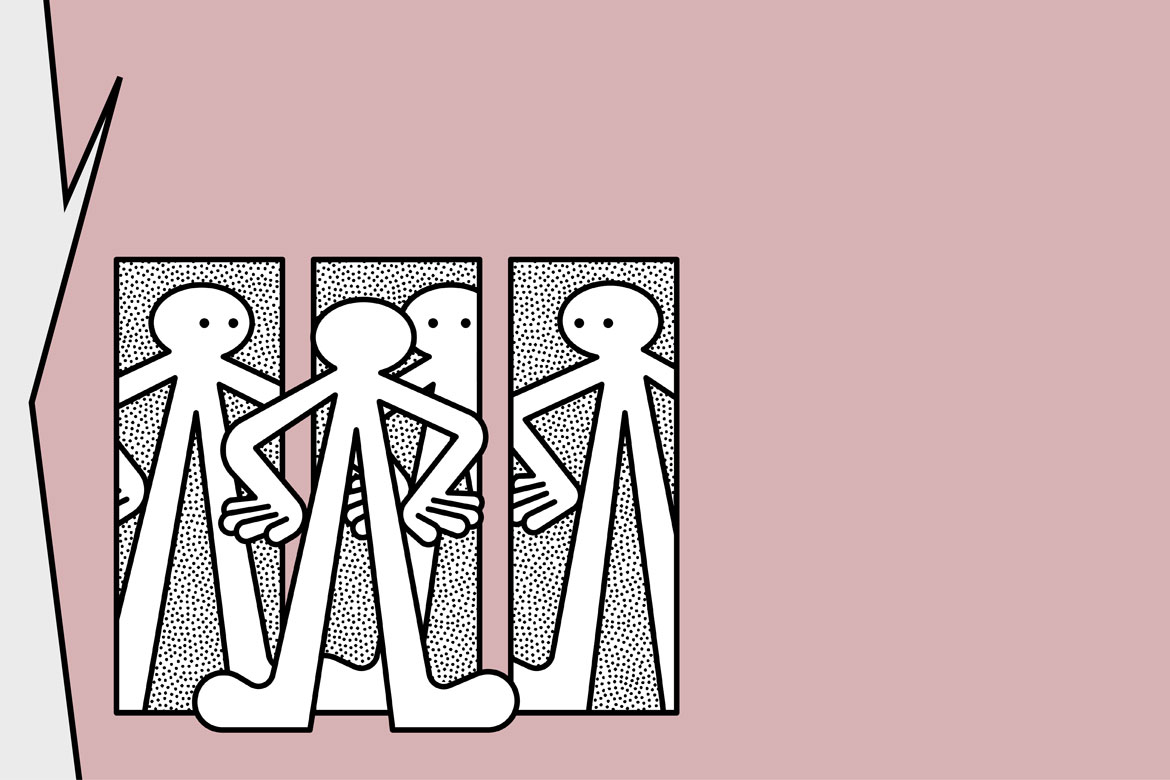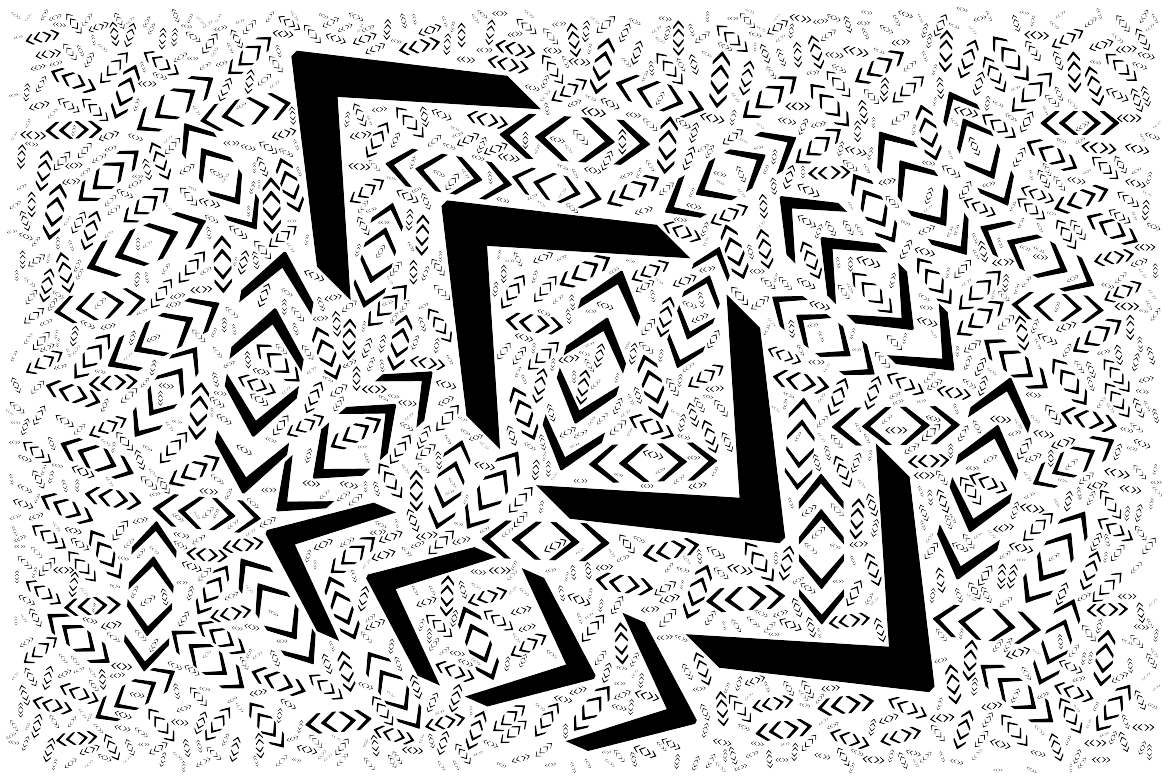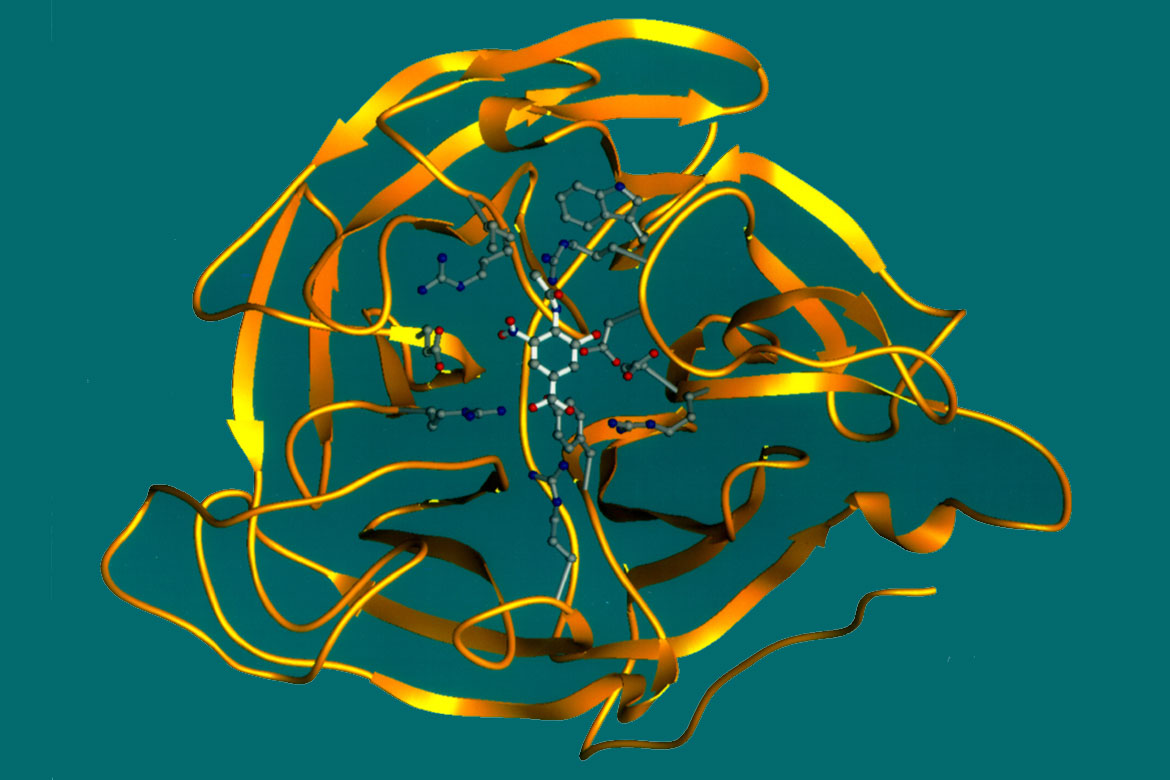Vernachlässigte Wissenschaft
Bloss nicht hinschauen
Ein ganzer Kontinent an ungestellten Fragen tut sich in der Wissenschaft auf, wenn man danach sucht. Eine Entdeckungsreise durch Prozesse der Verdrängung.

Vor allem auch bei sich selbst genau hinzuschauen ist manchmal schwierig. Auch deswegen entstehen blinde Flecken in der Wissenschaft. | Illustration: Joël Roth
«Inzwischen ist es ein Tabubruch geworden, wenn man ausspricht, dass nicht alle Akademikerinnen Karriereabsichten haben.» Das konstatierte die Wirtschaftswissenschaftlerin Margit Osterloh diesen Frühsommer in der Weltwoche. Im Artikel ging es um die heftigen Reaktionen, die eine Studie von ihr und der Soziologin Katja Rost geerntet hatte. Diese zeigte unter anderem auf, dass bei Weitem nicht alle Studentinnen eine akademische Karriere anstreben, sondern viele lieber Teilzeit arbeiten möchten.
Dieser Aufschrei scheint den Vorwurf der Cancel Culture zu bestätigen, der seit einigen Jahren prominent in Medienberichten erscheint. Es sind dabei in erster Linie linksgerichtete Gruppierungen, die sich ärgern. Von anderer Seite kam die Kritik am Freiburger Psycholinguisten Pascal Gygax. Er zeigt auf, wie stark die Wirkung des generischen Maskulinums auf unser Denken ist. Vor zwei Jahren erschien sein Buch dazu. In Horizonte erzählte er damals: «In den siebzehn Jahren meiner Forschung habe ich noch nie so viele Anfeindungen erlebt.» Hier waren es rechtspolitische Stimmen, die sich aufregten.
Beide Beispiele zeigen, dass politische Überzeugungen und mediale Aufmerksamkeit eine unheilvolle Dynamik entwickeln können. Sie kann besonders junge Forschende davon abhalten, in diesen Bereichen zu arbeiten.
Nicht gesehen, nicht gesagt
Ob in diesen Fällen von Tabus geredet werden sollte, wie es Osterloh tut, steht auf einem anderen Blatt. Nehmen wir die Definition der österreichischen Wissenschaftshistorikerin Ulrike Felt in einer ORF-Sendung zu Hilfe: «Tabus sind das Ungesagte und Unsagbare, sie sind implizite Handlungsanleitungen.» Sowohl, dass Frauen gerne Teilzeit arbeiten, als auch die Auswirkungen des generischen Maskulinums sind keine ungesagten oder unsagbaren Themen, sondern werden seit Jahren gesellschaftlich kontrovers diskutiert. Es handelt es sich demnach in beiden Fällen nicht um Tabuthemen.
Aber es sind Themen, die ganz bestimmte Überzeugungen tangieren und deshalb auf Widerstand stossen. Die Angst vor der negativen Reaktion kann zu blinden Flecken in der Forschung führen. Der deutsche Soziologe Jan Philipp Reemtsma definiert diese wie folgt: «Der blinde Fleck ist nicht das, was man nicht sieht, sondern eine Stelle im Auge, die verhindert, dass man etwas sieht – dass man sieht, wohin man doch blickt, eine zuweilen kleine Stelle, aber immerhin.» Also: Auch wo man hinschaut, gewisse Dinge bleiben ausgeblendet.
Natürlich verschwimmen die Grenzen zwischen Tabus und blinden Flecken. Es sind keine scharfen Bezeichnungen, aber man kann sich mit ihnen als Leitplanken durch die verdrängten, verpönten und vergessenen Themen in der Forschung bewegen. Davon gab und gibt es bedeutend mehr als diejenigen, die aktuell mit dem Cancel-Culture-Hammer verteidigt werden.
Am Beispiel der pädosexuellen Gewalt zeigt sich, welche Dynamiken spielen, wenn ein Thema in der Forschung für lange Zeit ausgeblendet wird. Die deutsche Erziehungswissenschaftlerin Meike Sophia Baader von der Universität Hildesheim war an der Aufarbeitung der sexualisierten Gewalt in den sogenannten Reformbewegungen beteiligt, also der Reformpädagogik, der Bildungsreform und den sexuellen Befreiungsbewegungen. Sie erzählt, wie das gesellschaftliche Tabu Sex ab Ende der 1960er-Jahre in bestimmten Kreisen mit der sexuellen Befreiung aufgebrochen wurde. «Jede sexuelle Aktivität galt dort nun als gut», erklärt sie. Selbst sexuelle Handlungen mit Kindern.
Baader belegt dies anhand der erziehungswissenschaftlichen Zeitschrift «Betrifft: Erziehung», die 1973 ein Themenheft mit dem Titel «Pädophilie – Verbrechen ohne Opfer» herausgab. Die Zeitschrift sei zu Beginn der 1970er-Jahre das pädagogische Magazin in der Bundesrepublik Deutschland mit der höchsten Auflagenzahl gewesen. «Sie war ein Forum für eine jüngere Generation von kritischen Bildungsforschenden sowie Bildungsreformerinnen und Bildungsreformern.»
Diese positive Aufmerksamkeit auf Sexualität und der Kampf gegen das gesellschaftliche Tabu Sex führten laut Baader dazu, dass man gleichsam blind war für andere Aspekte: «Die Rhetorik von der einvernehmlichen Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen ignoriert das Machtverhältnis zwischen den Generationen.» Es habe in den ganzen Diskussionen keine sichtbaren Positionen gegeben, die Kindern ein Nein zur Sexualität zugestanden.
Dort, wo es wehtut
Die Ignoranz für die Situation der Kinder ging so weit, dass der bekannte Erziehungs- und Sexualwissenschaftler Helmut Kentler im Buch «Plädoyer für Leihväter» noch 1989 beschreiben konnte, wie er im Rahmen eines sogenannten pädagogischen Experimentes Jugendliche von der Strasse bei pädosexuellen Männern unterbrachte. Es sei Kentler klar gewesen, dass es dabei zu sexuellen Handlungen kam. «Er war der Überzeugung, dass diese den Jugendlichen nicht schadeten, denn ihre Leihväter würden sie liebevoll behandeln und auf die Gesellschaft vorbereiten», erklärt Baader.
Bis zu diesem Zeitpunkt war das Leiden der Opfer ein blinder Fleck in den fortschrittlichen Erziehungswissenschaften. Eine bestimmte, vermeintlich befreiende Perspektive auf Sexualität sorgte für einen regelrechten Tunnelblick. Kentlers Experimente sowie die flächendeckende sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen im deutschen reformpädagogischen Internat, in der Odenwaldschule, gingen bis Ende der 2000er-Jahre respektive sogar bis Mitte der 2010er-Jahre weiter. «Es dauerte lange, bis die Betroffenen mediale, politische und wissenschaftliche Aufmerksamkeit bekamen», sagt Baader. «Zuerst gibt es so etwas wie verschwiegenes Wissen. Das ist der Knackpunkt daran. Dann wird es zwar ausgesprochen, aber niemand hört darauf.»
Noch 2020 sei es in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft vorgekommen, dass sexualisierte Gewalt an Kindern als Schmuddelthema bezeichnet wurde. «Bis eine Disziplin bereit ist, auch auf sich selbst zu schauen, das sind lange Prozesse», so Baader. «Zunächst ist das Thema komplett tabuisiert, dann wird dieses Tabu aufgebrochen und lässt sich nicht mehr vollkommen ignorieren. Irgendwann ist das Thema zwar kein Tabu mehr, aber man will es immer noch wegschieben.» Die bisweilen diffuse Wolke irrationaler Abwehrreflexe, die solche unsagbaren Themen oft umgibt, wird in Baaders Beschreibungen nahezu greifbar.
Meike Sophia Baader schaut weiter dorthin, wo es wehtut. Es gäbe auch aktuell Themen, die so unvorstellbar seien, dass sie kaum beforscht würden. Sie nennt etwa sexualisierte Gewalt in der frühen Kindheit bei Säuglingen und Kleinkindern. Dasselbe gelte für sexualisierte Gewalt in der Pflege, etwa an Menschen mit Beeinträchtigungen. «Die Gesellschaft, die betroffene Wissenschaftsdisziplin und oft auch die Forschenden wollen solche Themen einfach nicht an sich ranlassen, und sie sind ja auch schwer auszuhalten», erklärt Baader eindrücklich, was rund um ein Tabu passiert.
Einfach zu gefährlich
Neben unsagbaren bis unvorstellbaren Themen gibt es auch Forschungsbereiche, welche Gesellschaft und Wissenschaft so sehr ängstigen, dass sie diese lieber nicht angehen. Seit etwa fünfzehn Jahren wird zum Beispiel die künstliche Reduktion der Sonneneinstrahlung auf die Erde, das sogenannte Solar Radiation Management, kontrovers diskutiert. Einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verlangen nicht nur, dass die Technik selbst verboten wird, weil deren Auswirkungen einfach zu unberechenbar seien. Sie wollen auch deren Erforschung mit einem Bann belegen. Die Forschung bereite einerseits den Boden für einen späteren Einsatz der Technologie. Andererseits könne schon die Forschung «moralisch verantwortungsloses Verhalten hervorrufen, da die sich eröffnende möglicherweise einfache Lösung des Klimaproblems zu weniger Emissionsbeschränkungen führe». So fasst eine Forschungsgruppe um Wilfried Rickels von der Universität Kiel eines der Argumente gegen Solar Radiation Management zusammen.
Die mögliche Gefahr für die Zukunft führt hier zur Blockade der Beforschung einer Technik. Ähnlich ergeht es dem Klonen oder der Gewinnung von Stammzellen aus Embryonen, die in manchen Ländern mit Verboten belegt sind. Die österreichische Wissenschaftshistorikerin Ulrike Felt sagte dazu in einem Interview im Standard: «Meistens reden wir von Tabus, meinen aber Verbote. Tabus sind aber unausgesprochene Dinge, sie betreffen vor allem das, was nicht gesagt, gedacht, gefühlt oder berührt werden darf.»
Verbote wanken aber auch, wenn technologisch mehr möglich wird. Im Juni haben Forschende aus Cambridge künstliche Embryonen aus Stammzellen erzeugt. Die Schweizer Ethikerin Ruth Baumann-Hölzle meinte in einem Interview mit SRF auf die Frage, wie weit Forschung gehen darf: «Letztendlich setzt sich immer der sogenannte technische Imperativ durch, der das Machbare zum Ziel hat. So hat etwa die internationale Agentur für Biomedizin nach der erfolgreichen Erzeugung synthetischer Mäuseembryonen bestimmte Richtlinien unverzüglich gelockert.»
Doch selbst wenn eine Befürchtung durch Forschung widerlegt wurde, kann ein Thema noch unterdrückt werden – allerdings in umgekehrter Richtung. Der Technikhistoriker David Gugerli von der ETH Zürich erinnert sich an ein Gesuch, das die Forschungskommission der ETH beurteilen musste. Die Antragstellenden wollten herausfinden, ob sich der Bau von Mobilfunkantennen negativ auf den Preis von Immobilien an ihrem Standort auswirkt. Die Kommission wollte den Antrag zunächst ablehnen, weil die gesundheitsschädliche Wirkung von Mobilfunkantennen nicht nachweisbar sei und deshalb auch kein Effekt auf die Immobilienpreise erwartet werden könne. Gugerli erhob damals Einsprache: «Hier wurde Forschung tabuisiert, weil sie eine Nähe zu einem Thema hatte, das als unwissenschaftlich galt.»
Der maximale Tunnelblick
Die Angst vor einem Reputationsschaden wegen eines vermeintlich unseriösen Themas spielte hier vermutlich eine wichtige Rolle. Gugerli nennt noch andere Bereiche, die in seiner Disziplin kaum untersucht werden. So sei es heute in der Technikgeschichte etwa verpönt, an alten Techniken wie Velos oder Wellblech zu forschen. «Das ist nicht sexy.» Aus dem Verdikt «uninteressant» oder zumindest «nicht neu» entsteht hier ein blinder Fleck.
Der Wissenschaftshistoriker Pascal Germann von der Universität Bern sieht eine weitere wichtige Dynamik am Werk, wenn Themenbereiche kaum beleuchtet werden: «Es gibt immer neue Forschungsparadigmen. Diese bringen neues Wissen hervor und verändern den Blick auf die Wirklichkeit, sie erzeugen aber immer auch Bereiche von Nichtwissen.» Um das zu illustrieren, verweist er auf die Bakteriologie: «Einer der ganz grossen Durchbrüche in der Medizingeschichte.» Ab dem späten 19. Jahrhundert habe man gewusst, dass Infektionskrankheiten auf Mikroben zurückzuführen sind. «Von da an hat man sich auf diese Ursache festgelegt. Damit rückten andere Zusammenhänge in den Hintergrund. So galten nun Forschungen zu den sozialen Bedingungen dieser Krankheiten als veraltet.»
Bei der Tuberkulose, der «Killerin des 19. Jahrhunderts», war es insbesondere «die Arbeiterbewegung, die von einer sozialen Krankheit sprach», sagt Germann. Wie man heute weiss, war die Tuberkulose tatsächlich in den unteren sozialen Schichten viel stärker verbreitet, und der Rückgang der Sterblichkeit war vor allem auf eine Verbesserung der sozialen Bedingungen zurückzuführen. Laut Germann prägten bei Covid-19 «ähnliche reduktionistische Sichtweisen» die Diskussionen. Erfahrungsberichte aus Spitälern hätten sehr früh gezeigt, dass Leute in prekären Berufen stärker betroffen waren. «Diese soziale Dimension hat man aber erst mit der Zeit in den Blick genommen.» Er betont deswegen: Eigentliche Tabus seien selten dafür verantwortlich, wenn Themen nicht beforscht werden, sondern vielmehr bestimmte Paradigmen und politische Kontexte.
Bei Desinteresse und dominierenden Paradigmen entstehen blinde Flecken in der Forschung eher als Kollateralschäden. Sie zielen nicht darauf ab, ein Thema zu unterdrücken. Es wird für die Wissenschaft auch nicht unangenehm, wenn jemand diese ausgeblendeten Bereiche dann doch ins Blickfeld rückt. Von Themen jedoch, die zu sehr wehtun und/oder die eigene Disziplin infrage stellen, wird der Blick mit einer gewissen Absicht abgewendet. Das gilt auch für die politisch motivierte Ausblendung von Inhalten. Für die Forschenden in den betroffenen Bereichen ist es sehr unangenehm, wenn ihnen dann jemand den Kopf so drehen will, dass sie es trotzdem sehen müssen. Zum Ideal der Wissenschaft gehört es jedoch, auch die unbequemen Fragen zu stellen. Um dem gerecht zu werden, muss sie auch dann sehr präzis beobachten und umfassend arbeiten, wenn es bei ihr selbst unangenehm wird.