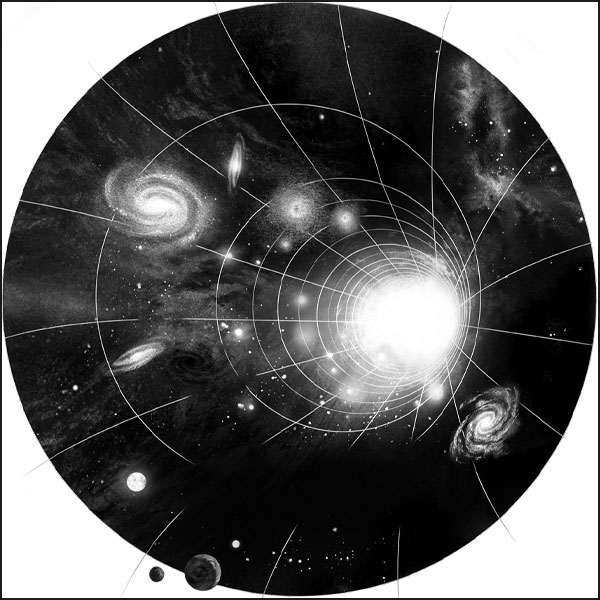HOCHBEGABTE
Tiefes Alter, hoher IQ
Superintelligente Kinder waren an Schweizer Hochschulen noch vor wenigen Jahren nicht unbedingt willkommen. Nun bemühen sich diese verstärkt um die Aufnahme junger Ausnahmetalente. Eine Erkundungstour.

Praktische Prüfung an der internationalen Chemie Olympiade 2023 in der Schweiz. | Foto: ETH Zürich / Luca Ferrari
Bereits im Alter von 14 Jahren begann Kathryn Hess ihr Studium an der University of Wisconsin-Madison in den USA. Das hat sie bis heute nicht bereut. Ihr IQ sei «hoch genug», meint Hess am Telefon scherzend, aktuell Professorin für Mathematik an der EPFL. «Die Universitäten in den USA sind sehr flexibel und zeigen grosses Interesse an begabten Studierenden», sagt sie. «Hätte ich damals in der Schweiz gelebt, wäre ich vielleicht einen anderen Weg gegangen.» Das musste etwa Maximilian Janisch tun, der einen IQ von über 149 hat. Sein Fall ging 2011 durch die Medien, als die ETH Zürich ihn nicht aufnahm, weil er mit 9 Jahren zu jung sei. Er studierte später im französischen Perpignan.

«Auch heute noch halten es gewisse Hochschulen für unnötig, sich um hochbegabte Studierende zu bemühen, denn sie haben bereits einen guten Ruf», meint Regula Haag, Geschäftsführerin der Stiftung für hochbegabte Kinder in Zürich. «Andere haben erkannt, dass es wichtig ist, solche Talente zu rekrutieren, weil diese sonst in die USA oder nach Grossbritannien abwandern.»
Im harten Wettbewerb um die klügsten Köpfe, die zu besseren Rankings und höheren Mitteln beitragen, zeigen inzwischen auch die Schweizer Universitäten ein wachsendes Interesse. Sie lancieren etwa Initiativen, um Hochbegabte anzuziehen und zu halten. Alle kontaktierten Fachleute sind sich jedoch einig, dass noch Optimierungspotenzial besteht.

Als hochbegabt gilt ein Kind, das in einem oder mehreren Fächern intellektuell überdurchschnittliche Leistungen erbringt, was sich in der Regel mit einer Punktzahl von über 130 in einem IQ-Test niederschlägt. «Diese Kinder wollen tiefer in Themen eintauchen und schneller lernen», erklärt Haag. Es besteht deswegen das Risiko, dass ihnen langweilig wird, sie depressiv werden oder schlechte Leistungen erbringen. Deshalb kann es sinnvoll sein, dass sie Klassen überspringen und bereits als Teenager eine Hochschule besuchen.
In den letzten zehn Jahren haben die hiesigen Hochschulen damit begonnen, Programme für Maturitätsschulen anzubieten, die für solche Jugendlichen attraktiv sind. Die EPFL lancierte etwa den Euler Course, einen Mathematikkurs für rund 30 überdurchschnittliche, aber nicht zwingend hochbegabte Schülerinnen und Schüler.
Die Universitäten Zürich, Bern, Basel, Luzern und Genf bieten spezielle Programme namentlich in Natur- und Ingenieurwissenschaften, Technik und Mathematik. Oft erhalten die Jugendlichen die Möglichkeit, am jeweiligen Institut Credits zu erwerben und das erste Jahr eines Bachelor-Studiums zu absolvieren.
Es ist jedoch schwierig, begabte Jugendliche aus allen Gesellschaftsschichten zu erreichen. Bei der Hochbegabtenförderung sind Mädchen untervertreten. «Jungs sind eher wettbewerbsorientiert, Mädchen eher geneigt, sich anzupassen und ihre Freundschaften nicht zu verlieren, als anzugeben oder Klassen zu überspringen», erklärt Katarina Farkas, Begabungsforscherin an der Pädagogischen Hochschule Zug. Kathryn Hess von der EPFL weist darauf hin, dass die speziellen Programme eher Jugendliche aus dem akademischen Umfeld ansprechen, andere dagegen gar nicht auf die Idee kommen, diese zu belegen. Sie plädiert deshalb für ein vielfältiges Angebot und gezielte Sensibilisierungsprogramme.

Für ein Studium an einer Schweizer Universität müssen Hochbegabte wie alle anderen die Zulassungskriterien erfüllen. Zwar gibt es in der Regel keine Altersbeschränkung, die Maturität ist jedoch Voraussetzung. «Wir achten sehr auf Gleichbehandlung, was auch richtig ist, aber in Ausnahmefällen könnten wir die Regeln grosszügiger auslegen», findet Hess.
Intelligenz ist das eine. Doch sind Kinder einem erwachsenen Umfeld sozial und psychologisch gewachsen? «Jeder Fall ist anders, aber wenn das Kind von der Schule unterstützt wird und Selbstständigkeit zeigt, ist das Alter kein Problem», ist Haag überzeugt.

Eine Studie der US-Universität Vanderbilt aus dem Jahr 2021 untersuchte die psychologischen und sozialen Auswirkungen der beschleunigten Schullaufbahn über einen Zeitraum von 35 Jahren und fand keinen Grund zur Besorgnis. In der Regel erbringen die Hochbegabten gute Leistungen und schneiden sozial ähnlich gut ab wie andere Studierende. Die älteren Studierenden scheinen keine Probleme mit jüngeren Hochbegabten zu haben: «Die wenigen Leute, die wussten, dass ich jünger war, fanden das cool», erinnert sich auch Hess.
Trotzdem sollte man der Situation dieser Jugendlichen besondere Aufmerksamkeit schenken, findet Farkas: «Wenn das Kind Mühe hat, müssen wir es professionell unterstützen.» Sie schlägt vor, den Betroffenen eine Mentorin zur Seite zu stellen. Haag erinnert sich an «sehr begabte Studierende, die an der ETH Zürich bei der ersten Prüfung durchfielen, weil sie nicht wussten, wie man lernt – einfach, weil sie zuvor nie lernen mussten!» Viele wären zudem glücklicher, wenn sie selbst auf Tertiärniveau Basislektionen überspringen könnten, weil auch diese für sie langweilig sind. Einige US-Universitäten bieten deswegen massgeschneiderte Kurse und frühe Forschungsmöglichkeiten an. Doch im Schweizer Bologna-System sind Studiengänge standardisiert und schwierig abzuändern.
Bisher werden hierzulande Coaching und Ad-hoc-Kurse nur nach dem Bachelor angeboten. «Auf der Suche nach dem nächsten Nobelpreis konzentrieren sich die Hochschulen auf die Förderung ab Doktoratsstufe», erklärt Claus Beisbart, Koordinator des Begabtenförderungsprogramms an der Universität Bern. «Wir sollten uns jedoch früher Gedanken dazu machen.»
Eine grosse Hürde sind Ressourcen und Personal. Regula Haag ist überzeugt, dass bereits kleine Veränderungen helfen könnten: Sie schlägt vor, auf Hochbegabtenförderung spezialisierte Mentoren in die Leitungsgremien von Hochschulen aufzunehmen. Talente zu fördern, ist nicht nur gewinnbringend für die Betroffenen, sondern auch für die Hochschulen und die Gesellschaft. «Begabte Menschen können zur Lösung der Probleme unserer Gesellschaft beitragen, wenn wir sie nicht vernachlässigen und ihre Entwicklung unterstützen», ist Farkas überzeugt.