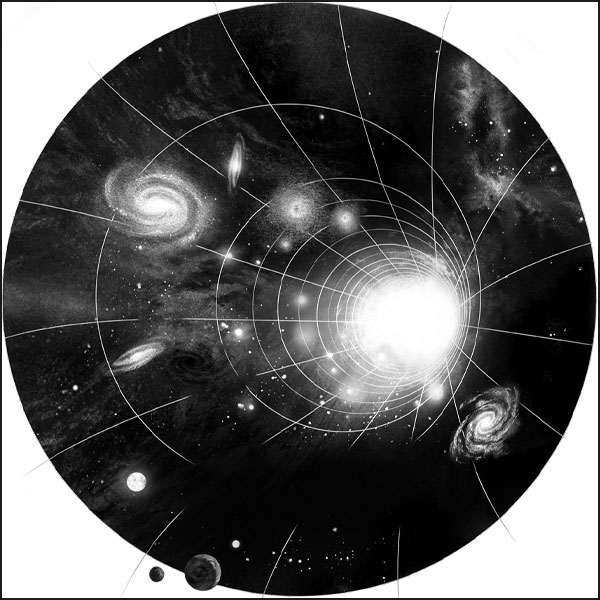WAHLFORSCHUNG
Hauptsache dagegen
Viele Wählende entscheiden sich nicht für eine bevorzugte Kandidatin, sondern gegen eine ungeliebte. Wie es zum Triumph der Abneigung in der Politik kommt.

Protest gegen den kurz zuvor gewählten republikanischen Präsidenten Donald Trump in New York am 9. November 2016. | Bild: Stacy Walsh Rosenstock / Alamy Stock Photo
Als Donald Trump 2016 gegen Hilary Clinton die US-Präsidentschaftswahl für sich entschied, hatte er eine wichtige Verbündete: die Negativität. Mehr als die Hälfte seiner Wählenden hatten nicht für ihn gestimmt, sondern gegen Clinton. Offenbar war die Demokratin bei der Stimmbevölkerung deutlich weniger beliebt.
Das ist keine historische oder geografische Eigenheit. Das Dagegen-Wählen gibt es in der Politik seit eh und je – nicht nur in den USA. 2023 wurde die Grünliberale Tiana Moser im zweiten Wahlgang als Zürcher Ständerätin wohl gewählt, weil viele den SVP-Kandidaten Gregor Rutz verhindern wollten, ohne besondere Sympathien für Moser zu hegen. Und als 2002 in Frankreich im zweiten Wahlgang der bei Linken unbeliebte Jacques Chirac gegen Jean-Marie Le Pen antrat, gaben viele Linke ihre Stimme doch lieber Chirac als dem rechtsextremen Le Pen. Das Phänomen ist eine elementare Tatsache des politischen Lebens.
Doch was treibt Menschen dazu an, negativ zu wählen? Und wie einflussreich ist diese Art, die eigene Meinung kundzutun? Damit beschäftigt sich die Forschungsgruppe von Diego Garzia an der Universität Lausanne. «Negative Politik ist ein Überbegriff, der verschiedene Arten der politischen Negativität vereint», erklärt er. Ihn interessiert vor allem, wie sich diese in der Bevölkerung manifestiert und im Wahlverhalten zeigt. Dabei stützt er sich auf die Auswertung von Langzeitdaten bei Nachwahlbefragungen. «Es gibt eine Tendenz, sich emotional von der bevorzugten Partei zu distanzieren und ungeliebte Kandidaten stärker abzulehnen», sagt Garzia.
Er unterscheidet bei der Untersuchung zwischen der Polarisierung der Parteien – also deren ideologischen Differenzen – und der affektiven Polarisierung der Wählenden: «Damit messen wir, wie gross die Abneigung von Wählenden gegenüber der Opposition ist.» Diese Abneigung habe sich in den Mehrparteiensystemen Europas nicht signifikant vergrössert, weil sie schon immer hoch war. «Auch bei einer SP-Wählerin ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass sie eine Initiative der SVP unterstützt – und umgekehrt», sagt Garzia.
Mehrparteiensystem als Gegengift
Was sich jedoch verändert, ist die sogenannte Polarität der Wählenden. «Es macht einen Unterschied, ob jemand Partei A zu hundert Prozent unterstützt und Partei B nur zu fünfzig oder ob jemand Partei A zu fünfzig Prozent unterstützt und Partei B gar nicht», erklärt Garzia. «Die eine Person wird beim Wählen durch Zuneigung motiviert, die andere durch Abneigung.»
Auch wenn die Differenz der Unterstützung bei beiden gleich sei, verändere sich die Qualität. Sie rutscht ins Negative, weil weniger Menschen grosse Sympathien für Parteien und Politiker hegen – und dafür grosse Antipathien. «Das Resultat ist eine Politik, die sehr stark durch Abneigung geprägt ist.»
Negatives Wählen muss aber nicht zwingend schlecht für die Demokratie sein, erklärt Thomas Milic vom Liechtenstein-Institut in Bendern (LI), der ebenfalls das Schweizer Abstimmungsverhalten erforscht. «Gerade in Majorzwahlen mit mehreren Runden geht es anfangs darum, Sympathien zum Ausdruck zu bringen, um in späteren Runden jene Person zu finden, die von einer Mehrheit akzeptiert werden kann», sagt Milic. «Aus Sicht der Wählenden geht es darum, das grösste Übel auszumerzen.» Mit einer Kandidatin der GLP könnten Linksaussen-Wählende wohl leben – aber nicht mit einem SVP-Kandidaten.
«Mehrparteiensysteme sind ein Gegengift zur negativen Politik», sagt auch Garzia. Entsprechend pendle der Anteil negativ Wählender in Europa um zehn Prozent. Das hänge auch damit zusammen, dass es für die Regierungsbildung oft Koalitionen benötige. «Die Parteien müssen nach der Wahl miteinander arbeiten. Je mehr Negativität in der Schüssel war, desto bitterer schmeckt anschliessend das Gericht.» Was noch unerforscht ist: Wie hängt das alles mit der Wahlbeteiligung zusammen? «Ich vermute, dass stark negativ polarisierte Menschen häufiger wählen», sagt Garzia. «Das könnte erklären, warum Kampagnen immer gehässiger werden. Diese Negativität könnte jene Leute an die Urne bringen, die es für den Wahlerfolg braucht.»