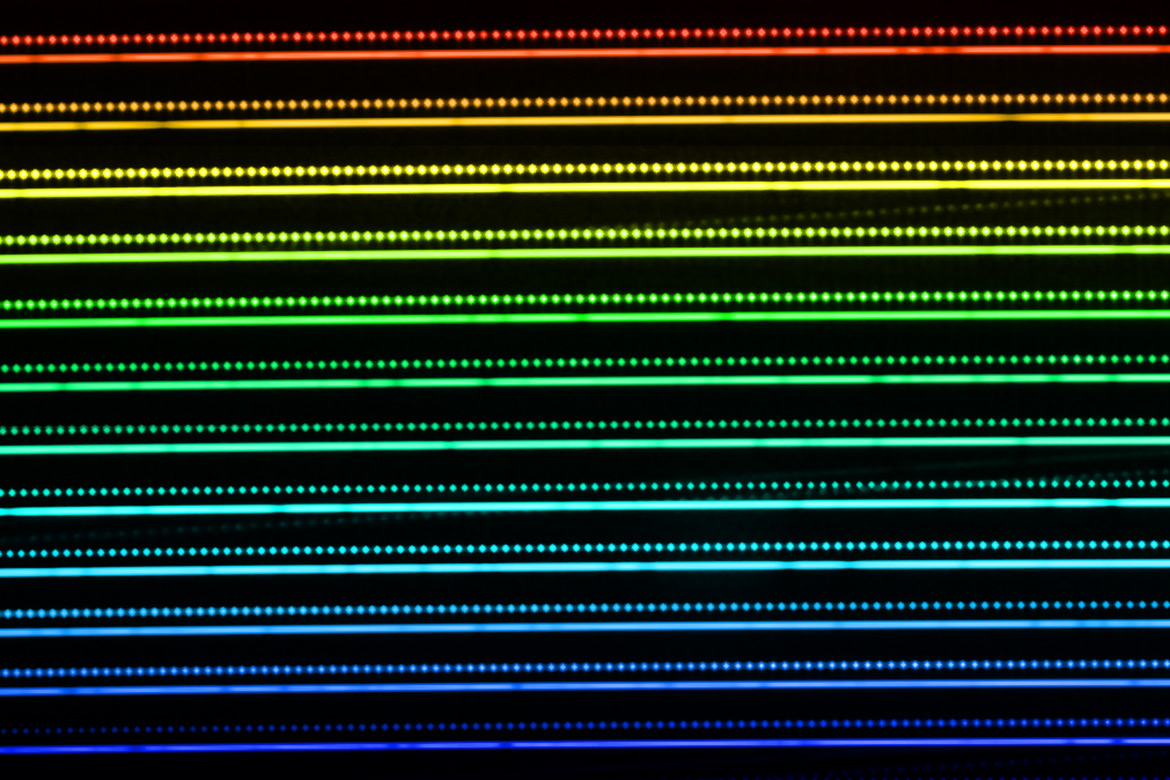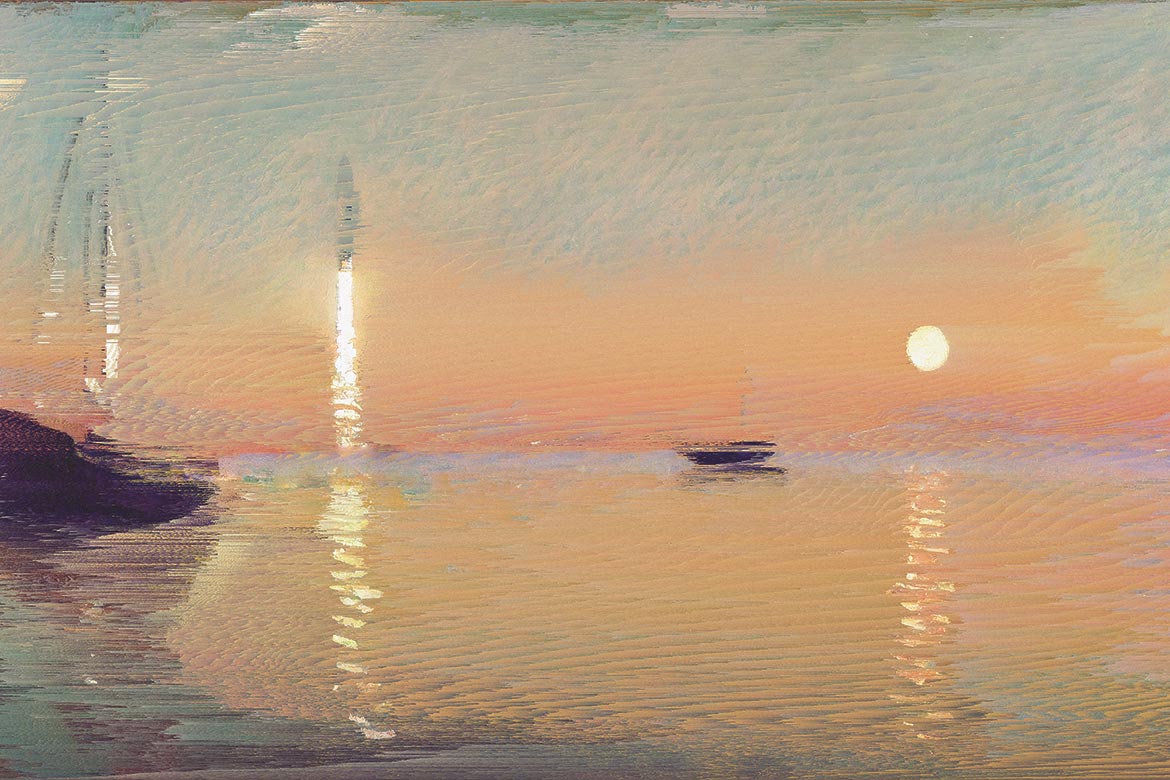Fokus: Start up in den Businesshimmel
Das Patent für den Erfolgsfall
Geistiges Eigentum widerspricht eigentlich dem Ideal des freien Austausches unter Forschenden. Doch wer seine Erfindung auf den Markt bringen möchte, braucht ihren Schutz und wird von den Hochschulen beim Papierkram unterstützt.

Damit die Spin-off die Chance hat ein echtes Unicorn zu werden, das über eine Milliarde US-Dollar Wert ist, muss die Erfindung vor der Konkurrenz geschüzt werden. Dies geschieht meistens mit einem Patent. | Foto: Lucas Ziegler
«Was denken Sie, wie viele Patente stecken in einem Smartphone?», fragt Gaétan de Rassenfosse, Professor für Wissenschafts-, Technologie- und Innovationspolitik an der EPFL, provokativ. Die Zahl liege irgendwo zwischen 30 000 und 100 000. «Niemand weiss das so genau.» Diese Dimensionen illustrieren, wie zentral das Patent für Innovationen ist. Als das US-Parlament 1980 ein neues Gesetz zum geistigen Eigentum verabschiedete, zeigte sich ebenfalls deutlich, wie wichtig es für Unternehmen ist, als einzige eine Erfindung nutzen zu dürfen.
Firmen brauchen Sicherheit
Der sogenannte Bayh-Dole Act erlaubte den staatlichen Forschungsinstitutionen zum ersten Mal, das Nutzungsrecht ihrer Patente – Lizenz genannt – exklusiv an einzelne Firmen zu vergeben. Obwohl dadurch die Nutzung der mit öffentlichen Geldern finanzierten Erfindungen eingeschränkt wurde, stieg in der Folge die Zahl der von Hochschulen vergebenen Lizenzen. «Niemand möchte Arbeit in etwas investieren, das nachher allen zur Verfügung steht», ist de Rassenfosse überzeugt. Ganz besonders falle dies bei Forschungsresultaten ins Gewicht: «Die Technologien aus den Laboren sind sehr weit weg von einer Kommerzialisierung und benötigen daher noch viel Entwicklungsarbeit.»
Der Schritt aus der problemorientierten Forschung hinaus in die gewinnorientierte Wirtschaft falle vielen aber nicht leicht, sagt Christian Moser, Patentexperte am Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE). Dieses informiert angehende Gründerinnen unter anderem, ob und wie sie ihre Idee mit einem Patent schützen können. Wichtigster Punkt dabei: Sobald eine Erfindung öffentlich bekannt ist, sei es durch einen Vortrag, durch deren Publikation in einem Artikel oder in digitalen Kanälen, gilt sie nicht mehr als neu und ist damit nicht mehr patentierbar. «Zu viele Erfindungen verlieren ihre Patentierbarkeit wegen vorzeitiger Veröffentlichung durch die Erfinder selbst», bedauert Moser. Mit Vorträgen an Hochschulen, Technoparks und Start-up-Inkubatoren versucht er darum die sogenannte Intellectual Property Awareness anzuheben.
Eigene Patente schützen künftige Produkte vor Kopien durch die Konkurrenz und sichern so den Geschäftserfolg eines Spin-offs und seiner Investoren. Ebenfalls wichtig ist, ob die eigene Firma nicht Schutzrechte anderer verletzt. Neben Patenten können dies auch Marken-, Design- und Urheberrechte sein. Deshalb hilft das IGE abzuklären, ob und wo genau der Weg frei ist. Man spricht von Freedom to operate. «Wenn es ums Geschäft geht, gibt es nur zwei Formen von geistigem Eigentum: das eigene und das aller anderen», spitzt Moser die Situation zu.
Wem genau ein Patent gehört, ist im Falle von Hochschulforschung allerdings etwas komplizierter: Es gehört nämlich nicht den Forschenden, sondern ihrer Arbeitgeberin, also der Hochschule. Die Forschenden werden bei der Anmeldung lediglich als die Erfindenden aufgeführt – für Ruhm und Ehre. In der Regel behält die Hochschule sämtliche Patente und vergibt den Firmen lediglich Lizenzen – selbst an die von den eigenen Forschenden gegründeten Spin-offs. «Damit können wir verhindern, dass Patente gekauft und schubladisiert werden, nur um sich die Konkurrenz vom Halse zu halten», sagt Cornelia Fürstenberger, Technologietransfer-Managerin von Unitectra, dem gemeinsamen Büro für Technologietransfer der Universitäten Basel, Bern und Zürich.
Fast alle Hochschulen haben eine solche Fachstelle, die dazu dient, die Erfindungen auf eine Art zur Verfügung zu stellen, damit sie tatsächlich weiterentwickelt werden. Die Forschenden sollen ermuntert werden, Patente anzumelden, und dabei kompetent Unterstützung erhalten. Allerdings ist dies vielen nicht bekannt. «Wir sind froh, wenn die Leute frühzeitig auf uns zukommen, damit wir die Weichen richtig stellen können», sagt Fürstenberger.
Bei den Technologietransferbüros müssen sie einige juristische und kommerzielle Fragen genau beantworten: Was genau ist die Erfindung? Wer war alles daran beteiligt? Wurde Material von anderen verwendet? Gibt es einen Markt? Dann folgt ein Erfindermeeting, bei dem möglichst alle Beteiligten präsent sein sollten. Dort wird entschieden, ob eine Patentanmeldung möglich ist, ob sich der Aufwand dafür lohnt und, wenn ja, wie ein mögliches Produkt schliesslich aussehen würde. «Das ist wichtig zu wissen, denn ein Patent soll zukünftige Produkte möglichst gut abdecken, gerade wenn es für die Gründung eines Spin-offs gedacht ist», so Fürstenberger.
Knapp hinter Swatch und vor Nestlé
Die Hochschule übernimmt die Kosten für die Anmeldung des Patents. Wird ein Spin-off gegründet, sichert sie sich in der Regel einen Anteil am Umsatz und hält einen Anteil am Jungunternehmen selbst. Die finanzielle Bilanz ist für die Hochschulen unter dem Strich positiv. Fürstenberger betont aber, dass es nicht das Ziel der Büros für Technologietransfer ist, Geld zu verdienen, sondern einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Alle hiesigen Hochschulen zusammen reichten im Jahr 2021 insgesamt rund 300 Patente ein und kamen damit knapp hinter Swatch auf Platz zwei in der Schweiz, klar vor Nestlé, Philip Morris und Roche.
Ein Patent ist aber nicht die richtige Lösung für alle und alles. «Bei Bio- und Medtech-Start-ups geht es nicht ohne Patente», so der EPFL-Forscher Gaétan de Rassenfosse. Anders sei das im IT-Bereich, wo es Unternehmen ohne Patente gebe. Für Computercodes gilt wie bei Texten und Bildern automatisch das Urheberrecht. Viele Informationen, zum Beispiel die Trainingsdaten für KI-Anwendungen, sind schlicht Geschäftsgeheimnis, für dessen Schutz die Firma selbst sorgen muss. Es ist die Antithese zum Patent, das der Staat veröffentlicht und im Gegenzug ein befristetes Monopol garantiert, das zum Beispiel einem Spin-off Zeit verschafft, sein Produkt zur Marktreife zu entwickeln.