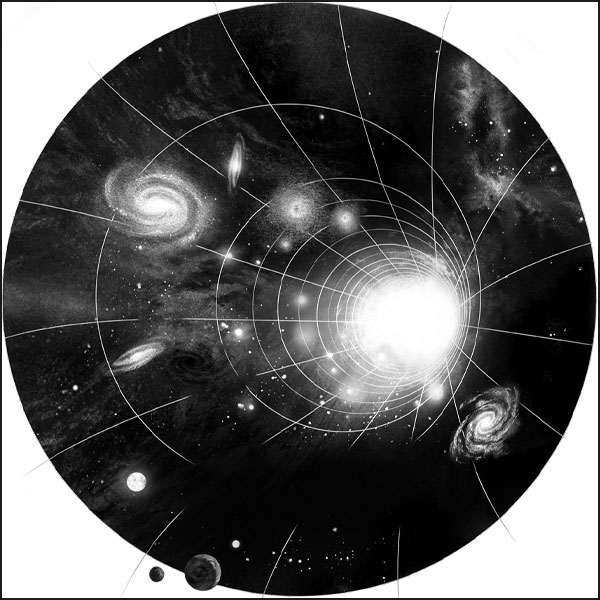STANDPUNKT
«Postkolonialismus ist Objekt des Kulturkampfes»
Die Auseinandersetzung um die postkoloniale Theorie ist hitzig. Der Historiker Kijan Espahangizi von der Universität Zürich wünscht sich deshalb mehr Differenzierung.

Kijan Espahangizi fordert mehr Selbstkritik innerhalb der postkolonialen Theorie. | Foto: Jonathan Labusch
Kijan Espahangizi, Sohn einer Deutschen und eines Iraners, Historiker an der Universität Zürich, forscht unter anderem zu Migrationsgeschichte, Rassismus und Multikulturalismus – mit postkolonialer Theorie, einem Ansatz, der polarisiert.
Kijan Espahangizi, was ist eigentlich postkoloniale Theorie?
Es ist ein offenes, heterogenes Feld mit einem gemeinsamen Nenner: Wer die Welt heute verstehen will, muss sich damit auseinandersetzen, wie sie vom europäischen Kolonialismus geprägt wurde. Die vergangenen Kolonialreiche wirken in Wirtschaft, Kultur, Politik und Wissenschaft immer noch nach. Das gehört längst zum Werkzeugkoffer vieler Historikerinnen, ohne dass sie sich als Vertreter der Theorie verstehen.
Trotzdem wird um den Ansatz gestritten.
Die Theorie war historisch stets eng an politische Fragen geknüpft. Gerade seit dem Aufflammen des Konflikts um den Gazastreifen ist Postkolonialismus zum Gegenstand des laufenden Kulturkampfes geworden. Die einen sehen darin eine linke Ideologisierung. Einige Vertreterinnen der Theorie reduzieren umgekehrt kritische Einwände vorschnell auf einen Angriff von Rechten.
Und das kritisieren Sie?
Ja, ich denke, eine solche Wagenburgmentalität fördert den Kulturkampf. Geistes- und Sozialwissenschaften stehen für kritische Reflexion – auch der eigenen Vorstellungen. Es muss möglich sein, sich gegen den politischen Angriff auf die Autonomie der Forschung zu wehren und gleichzeitig auch bestimmte Aspekte der eigenen Theorie zu kritisieren.
Welche Aspekte?
Die postkoloniale Theorie ist ein Kind der 1970er. Der Westen als Täter gegen den unterdrückten Rest der Welt. Es gibt eine Tendenz des Schwarz-Weiss-Denkens, das nicht in unsere heutige multipolare Welt passt. Ehemalige koloniale Einflussgebiete, China, Indien, Katar, Saudi-Arabien und Iran, sind längst globale Player geworden. Postkoloniale Ansätze tun sich schwer, islamistischen, russischen und chinesischen Imperialismus gleichermassen kritisch in den Blick zu nehmen. Selektive Kritik spielt geopolitisch den Falschen in die Hände.
Kurz: Die postkoloniale Theorie ist selbst eurozentristisch.
(Lacht.) Ja, das ist eine richtige Beobachtung. Kluge Forschende haben erkannt, dass die postkoloniale Forschung im Kern auch ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht wird.
Sie übten neulich an einer Podiumsdiskussion in Basel Selbstkritik. Wie kam das an?
Ich finde es stark, dass sich Studierende für einen differenzierten Debattenraum einsetzen. Genau das brauchen wir! Klar gab es eine Fraktion im Publikum, die keine Kritik hören wollte. Aber ich bin überzeugt, das ist nur eine laute Minderheit. Leider war auch auf dem Podium die Wagenburgmentalität zu spüren – nach dem Motto: Kritik muss in der Familie bleiben. Das schadet dem Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit. Wir sind ja keine politische Partei.