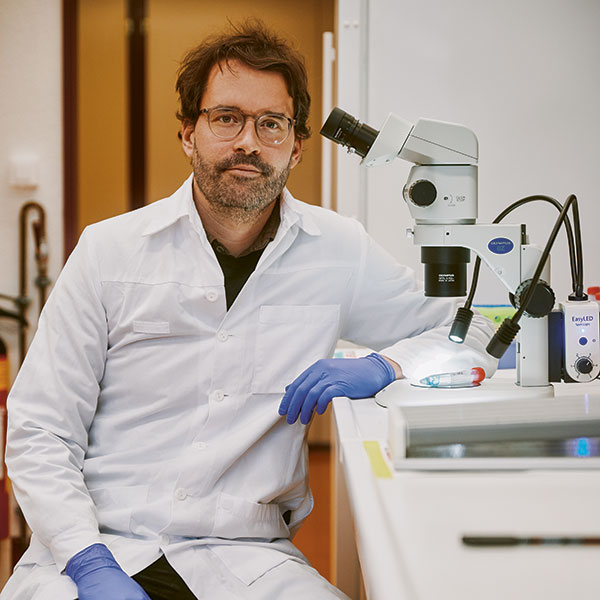Fokus: Ringen ums Wasser
„Ein Erfolgskriterium ist für mich, wenn niemand mehr schreit und droht“
Wasser ist Lebenselixier. Wenn es knapp wird, drohen Leid und Konflikte. Politologe Thomas Bernauer untersucht, wie sich Länder über die Nutzung streiten – und meistens einigen.

Politikwissenschaftler Thomas Bernauer spricht vom Mythos Wasserkrieg. Die Forschung sei sich einig, dass Wasser keine Ursache grosser Konflikte sei. | Foto Paolo Dutto/13Photo
Seit fast einem Jahr herrscht Krieg im Gazastreifen. Dabei wird immer wieder der Vorwurf laut, dass Israel Wasser als Waffe einsetze. Ist Wasser hier und andernorts ein Kriegstreiber?
Die eine Frage ist, ob sich an der Verteilung von Wasserressourcen ein bewaffneter Konflikt entzündet, Wasser also die Hauptursache ist. Da ist die Forschungslage relativ eindeutig: Die Antwort lautet Nein. Das ist der Mythos vom Wasserkrieg. Die zweite Frage ist, welche Rolle Wasserressourcen in bewaffneten Konflikten spielen, die aus ganz anderen Gründen entstanden sind. Russland hat in der Ukraine einen grossen Staudamm zerstört, der wichtig für die Wasserversorgung ist. Dahinter steckte eine militärisch-strategische Überlegung: Russland wollte der Ukraine wirtschaftlichen Schaden zufügen und mit Überschwemmungen einen Gegenangriff erschweren. In Gaza verknappt oder stoppt das israelische Militär die Wasserzufuhr, um den Leidensdruck der dortigen Bevölkerung zu erhöhen, auch das ist ein Mittel der Kriegsführung. In beiden Fällen ist das Wasser aber keine Konfliktursache.
Der spätere Uno-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali sagte doch 1985: «Der nächste Krieg im Nahen Osten wird um Wasser geführt werden.»
Diese Prophezeiung war falsch. Seit 1985 gab es in dieser Region einige bewaffnete Konflikte: im Irak, in Syrien, jetzt in Gaza. In Libanon herrscht praktisch dauerhaft ein niederschwelliger Krieg. Aber bei keinem dieser Kriege geht es im Kern ums Wasser. Vielleicht hatte Boutros-Ghali bei seiner Aussage sein Heimatland Ägypten vor Augen. Viele haben nämlich argumentiert: Wenn dereinst ein Krieg wegen Wasserverteilung ausgelöst werden könnte, dann beim Nil.
Worum geht es da?
97 Prozent des Oberflächenwassers Ägyptens kommen aus dem Ausland – so viel wie kaum sonst wo weltweit. In einer solchen Situation ist es natürlich extrem heikel, wenn ein anderes Land am Oberlauf des Nils grosse Wasserinfrastrukturen baut. Genau das hat Äthiopien mit dem Grand-Renaissance-Damm getan. Aber auch dort ist kein Krieg ausgebrochen.
Und warum brechen keine Kriege um Wasser aus?
Die plausibelste Antwort ist wohl, dass sich bei der Nutzung dieser Ressourcen vielfältige Möglichkeiten für Kompromisse finden lassen. So werden immer wieder Lösungen auf technischer und politischer Ebene gefunden. Beispielsweise kann ein Stausee im Oberlauf langsamer gefüllt werden, damit mehr Wasser für den Unteranliegerstaat im Fluss bleibt.
Konnten sich so auch Ägypten und Äthiopien einigen?
Ägypten hat bisher kein formelles Abkommen mit Äthiopien abgeschlossen. Aber es laufen schon lange Verhandlungen, und informell gibt es auch Absprachen. Jedenfalls füllt Äthiopien den Stausee langsamer, als es eigentlich könnte, und betreibt den Damm so, dass Sudan und Ägypten noch genug Wasser erhalten.
Was sind denn entscheidende Faktoren, damit Länder, die um Wasser konkurrieren, überhaupt ins Gespräch kommen?
Der Problemdruck muss relativ gross sein, und diejenigen Länder, die am meisten geschädigt werden, müssen den Schadensverursachenden wirtschaftlich und politisch einigermassen Paroli bieten können. Dann spielt auch der generelle Zustand der zwischenstaatlichen Beziehungen eine wichtige Rolle. Die Rheinanliegerstaaten beispielsweise haben seit bald 80 Jahren keinen Krieg mehr gegeneinander geführt. Der Nil hingegen, aber auch Euphrat und Tigris fliessen durch Länder, deren Verhältnis zueinander denkbar schlecht ist. Oft ist dann die Rede von Wasserdiplomatie: Dahinter steckt die Idee, dass es sich beim Wasser um eine Art technischen Gegenstand handle, der wenig mit Politik zu tun hat. Da können die Staaten die Zusammenarbeit üben. Wasserdiplomatie hat gemäss meiner Beobachtung jedoch kaum dazu beigetragen, übergeordnete Konflikte zu lösen.
Woran misst sich denn der Erfolg von Verhandlungen bei Wasserproblemen?
Einerseits im Vergleich der von den Staaten angestrebten Zielwerte mit der Realität beispielsweise bei Wasserqualität oder Abflussmengen. Man kann den Erfolg aber auch daran festmachen, wie zufrieden die unterschiedlichen Stakeholder mit dem Verhandlungsergebnis sind. Ein Kompromiss ist ja eine Situation, in der niemand ganz glücklich ist, der aber für alle akzeptabel ist. Ein Erfolgskriterium ist für mich, wenn niemand mehr schreit und droht und alle mit dem erreichten Zustand leben können.
Gibt es aus der Geschichte ein Beispiel für einen gelösten Wasserkonflikt?
Es gibt sogar viele. Etwa beim Syrdarya, einem grossen Zubringerfluss zum Aralsee. Dieser lag früher komplett in der Sowjetunion. Mit deren Zusammenbruch wurde er zum internationalen Gewässer. Kirgistan gelangte dadurch nahe der Grenze zu Usbekistan in den Besitz eines grossen Staudamms, der enorm wichtig für die kirgisische Energieversorgung, aber auch die Wasserversorgung in Usbekistan ist. Kirgistan änderte ab 1991 den Betriebsmodus des Damms, um im Winter mehr Strom zu produzieren, ganz zum Nachteil der Landwirtschaft in Usbekistan, das heftigst protestierte und drohte. Eine Serie formeller und informeller Abkommen hat mittlerweile diesen Konflikt recht gut unter Kontrolle gebracht.
In Europa spielen sich Wasserkonflikte meistens innerhalb eines Landes ab, beispielweise rund um die Erdbeerfelder in Spanien. Spielen da die gleichen Mechanismen der Konfliktlösung?
Generell kann man wohl sagen, dass sich solche Konflikte einfacher lösen lassen, solange der Staat einigermassen funktioniert. International müssen Lösungen auf horizontaler Ebene gesucht werden, wo sich juristisch ebenbürtige Partner treffen. Das produziert oft Lösungen des kleinsten gemeinsamen Nenners. Innerhalb eines Landes aber spielt die ganze Hierarchie eines Staates. Viele Wasserkonflikte werden vor Gericht oder durch Gesetze begrenzt oder gelöst. Wenn etwa das Schweizer Parlament ein neues Gewässerschutzgesetz erlässt, ist es egal, ob ein einzelner Kanton oder eine einzelne Stadt das gut findet, alle müssen sich daran halten.
In Europa sorgte der Rhein immer wieder für Konfliktstoff.
Beim Rhein ging es meist um Verschmutzung durch Abwässer aus Industrie und Haushalten. Die Hauptleidtragenden waren die Holländer, die auch immer wieder protestierten. Dem Rhein geht’s heute relativ gut. 1950 wurde die Rheinschutzkommission mit allen Anrainerstaaten gebildet, und dort wurden viele Abkommen geschlossen. Die massgeblichen Verbesserungen der Wasserqualität resultierten jedoch aus nationalen Vorschriften, Kläranlagen, Phosphatverboten und so weiter. Heute geht es beim Rhein vermehrt um die Ökosystem-Perspektive. Das ist vielleicht eine Luxuserscheinung: Wenn man die schlimmsten Verschmutzungen im Griff hat, kann man sich auf Biodiversität und Naturschutz konzentrieren.
Wagen Sie eine Prognose: Wo entstehen in den nächsten Jahren neue Wasserkonflikte, wo werden welche gelöst?
Grosse zwischenstaatliche Kriege um Wasser halte ich weiterhin für sehr unwahrscheinlich. Lokale innerstaatliche Konflikte um die Verteilung werden hingegen wohl leider zunehmen. Viele Länder leiden vermehrt unter dem Klimawandel, Niederschläge verteilen sich unregelmässiger und sind schwerer abzuschätzen. Es gibt also häufiger Perioden von zu viel Wasser und auch mehr Dürreperioden. Wenn bei wachsender Bevölkerung der Kuchen kleiner oder seine Grösse unvorhersehbar wird, sind Konflikte programmiert. Eine Eskalation hin zu Gewalt dürfte aber weitestgehend auf sehr arme und politisch, sozial und wirtschaftlich instabile Staaten beschränkt bleiben.
Warum?
Es braucht gut funktionierende Infrastrukturen und Institutionen. Reiche Demokratien weisen dafür gute Voraussetzungen auf. In vielen Ländern des globalen Südens ist dies weit schwieriger, weil dort die staatlichen Institutionen wie Verwaltungen und Gerichte meist nur schlecht funktionieren. Zudem haben diese Staaten wenig Geld, um neue Infrastrukturen wie Reservoire oder Bewässerungssysteme aufzubauen und zu unterhalten. Hinzu kommt die sehr ungleiche Wohlstandsverteilung in diesen Staaten, die sich auch im Zugang zu Wasser widerspiegelt.