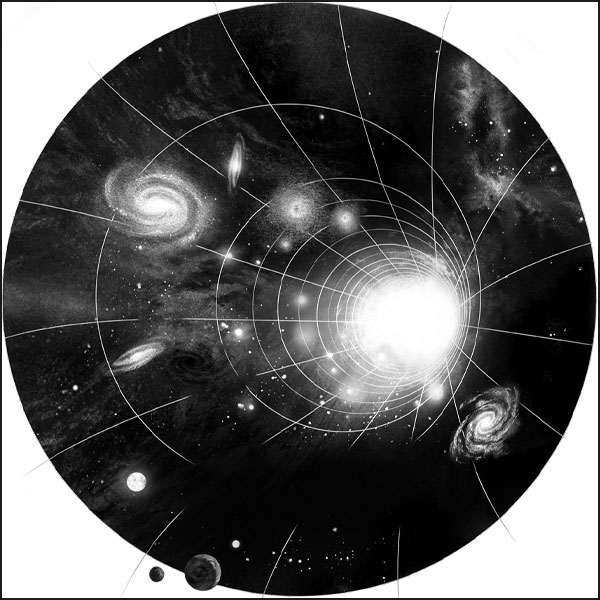Fokus: Forschung für den Frieden
Jahrhundert voller Wissenschaftsdiplomatie und Ernüchterung
Vom kleinen Programm für Zusammenarbeit zwischen Russland und der Ukraine bis hin zur mächtigen Rockefeller-Stiftung: Einblicke in die windungsreichen Geschichten der Friedensinitiativen aus der Forschung.

Das Cern brachte schon anno dazumal Nationen zusammen: Im Jahr 1964 wird dort das 10-jährigen Jubiläum der Unterzeichnung des Übereinkommens zur Gründung der Europäischen Organisation für Kernforschung gefeiert. | Foto: Photopress-Archiv / Keystone
Entsteht das Higgs-Boson, zerfällt es sofort wieder. Bis 2012 wurde es deshalb nur theoretisch beschrieben. Dann gelang sein experimenteller Nachweis im Large Hadron Collider am Europäischen Kernforschungszentrum (Cern) bei Genf. Das Higgs-Boson vervollständigt seither das Standardmodell der Teilchenphysik.
Diese Sensation war nur möglich geworden, weil das Zentrum über ein halbes Jahrhundert zuvor als Friedensprojekt gegründet worden war: Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die Teilchenforschung massiv an Ansehen verloren. Die Zerstörungskraft der Atombombenexplosionen in Hiroshima und Nagasaki und die humanitären Folgen führten zu einer weltweiten Diskussion über das Missbrauchspotenzial von Atomenergie.
Die Idee der grossen Brückenbauerin
Gleichzeitig war das Interesse der Wissenschaft an der Kernspaltung riesig. Deshalb sollte die Teilchenforschung in einen neuen Kontext eingebettet werden, zur Sicherung des Friedens als internationale Zusammenarbeit. Diese Idee wurde zum Gründungsfunken des Cern.
Der Grundsteinlegung 1955 gingen jahrelange diplomatische Mühen voraus, um möglichst viele Länder und Regierungen davon zu überzeugen. Mit Erfolg: Zwölf Nationen unterzeichneten die Gründungsurkunde. Heute sind 32 Länder direkt beteiligt, in über 100 Ländern forschen weit über 10 000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Cern-Projekten.
«Bei der Gründung waren Politiker bereit, weit über die eigene Legislatur hinauszudenken, und mit der Friedenssicherung durch wissenschaftliche Kooperation teilten alle ein übergeordnetes gesellschaftliches Anliegen», sagt Leo Eigner. Der 29-Jährige forscht am Center for Security Studies der ETH Zürich zur Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Technologie und internationalen Beziehungen. Ein Konzept, das alle drei Bereiche verbindet, ist die Wissenschaftsdiplomatie. Das Cern gelte heute als ein Paradebeispiel dafür.
Die Idee dahinter: Wissenschaft wird zur Brückenbauerin. Mit ihr werden bi- und multilaterale Partnerschaften und Abhängigkeiten gefördert, um Beziehungen zu stabilisieren. So kann ein friedensfördernder Dialog über nationale und kulturelle Grenzen hinweg entstehen. Möglich wird das, weil Wissenschaft als universell und überparteilich gilt. Und sie wird immer mächtiger, weil sie Antworten auf die grössten Herausforderungen dieser Zeit geben kann: Ob das die Bekämpfung einer globalen Pandemie ist oder Klimaschutz, keine Nation löst diese Probleme allein.
Schon gar keine kleine Nation wie die Schweiz. «Es ist deshalb kein Zufall, dass das Cern hier steht», sagt Eigner. Vor allem liege das an der Schweizer Neutralität, aber auch daran, dass das Land früh bereit gewesen sei, sich an der zunehmenden Internationalisierung der Wissenschaft zu beteiligen und später Big-Science-Projekte und Wissenschaftsdiplomatie zu zentralen Elementen seiner Aussenpolitik zu machen. Mit dem Weltklimarat ist noch eine zweite der wichtigsten internationalen Organisationen hier beheimatet.
«Die Praxis, dass Länder für gemeinsame Vorhaben zusammenarbeiten, gibt es seit Jahrhunderten. Die gegenwärtige Wissenschaftsdiplomatie wurde aber erst 2010 populär», erklärt Eigner. In diesem Jahr hat die britische Royal Society gemeinsam mit der American Association for the Advancement of Science Wissenschaftsdiplomatie definiert und sie in drei Formen eingeteilt: «Science in Diplomacy» nutzt wissenschaftliche Erkenntnisse für die Aussenpolitik, um bestmögliche Entscheidungen zu treffen. «Diplomacy for Science» beschreibt den Einsatz diplomatischer Mittel, um internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit zu fördern. Bei «Science for Diplomacy» agiert die Wissenschaft selbst diplomatisch.
Dank Stipendien zur Supermacht
Frieden soll nicht nur mit Wissenschaftsdiplomatie gefördert werden, es gibt auch gemeinnützige Organisationen, die explizit zu diesem Zweck gegründet wurden. Eine ist die Rockefeller Foundation. «Sie wurde 1913 ins Leben gerufen, um durch Wissenschaft einen Beitrag zum Weltfrieden zu leisten. Und das ist bis heute ein erklärtes Ziel», sagt Ludovic Tournès, Professor für globale Geschichte an der Universität Genf.
Zuletzt hat er sich mit einem Team aus acht Kollegen und Kolleginnen mit Stipendiaten der Stiftung beschäftigt, die sie als «Botschafter der Globalisierung» bezeichnen. Ein Stipendien-Programm der Stiftung lief von 1917 bis 1968 und ermöglichte insgesamt fast 14 000 jungen Menschen aus knapp 130 Nationen ein Studium in Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften. Viele bereisten dafür andere Länder. Das Ziel war, so Tournès, dass die Stipendiatinnen dank ihrer Ausbildung zu «modernen, freien und offenen Märkten und stabilen Staaten» auf der ganzen Welt beitragen können.
Aber ob das nun Frieden gefördert hat? «Das können wir nicht beurteilen, weil philanthropische Stiftungen keine Behörden sind oder politische Entscheidungen treffen», erklärt Tournès. «Was wir aber zeigen konnten: Die Rockefeller Foundation hat durch ihre Stipendienpolitik dafür gesorgt, dass die USA ab Mitte der 1920er zum Gravitationspunkt der transnationalen wissenschaftlichen Zirkulation wurden. » Die vielen Austausch- und Förderprogramme ermöglichten nicht nur den Aufstieg der USA zur wissenschaftlichen Supermacht, sondern auch zu einer wichtigen wissenschaftsdiplomatischen Akteurin – mitgeprägt durch die Rockefeller Foundation.
Forschung kann auch das Gegenteil von Friedensförderung bewirken, etwa wenn sie in einem unfreien System agiert oder davon sogar profitiert. Das zeigt die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, eine deutsche Forschungsinstitution, die innerhalb und mit dem NS-Regime arbeitete. Die Gesellschaft hat zwar keine Waffen entwickelt oder gebaut, aber sie war etwa an der Rüstungsforschung, der sogenannten Rassenlehre und an Züchtungsforschung für die Ostexpansion beteiligt.
Im eigenen Haus trotzdem abgemahnt
Mit Ende des Zweiten Weltkriegs wollten die Alliierten deshalb die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft dichtmachen – aus Angst, ihre Forschung könnte zum Wiedererstarken Deutschlands beitragen. Aber vor allem die Briten pochten darauf, die Gesellschaft zu erhalten. Und das gelang. Sie erhielt einen neuen Namen, Max-Planck-Gesellschaft, und sollte sich inhaltlich neu ausrichten. «Dafür bediente man sich eines diskursiven Tricks», erklärt Carola Sachse. Die emeritierte Professorin für Zeitgeschichte der Universität Wien hat vor kurzem ein Buch über die Institution und ihre Rolle in der internationalen Politik von 1945 bis 2000 veröffentlicht.
«Der Trick war der, dass die Max-Planck-Gesellschaft fortan nur mehr Grundlagenforschung und keine angewandte Forschung betreiben wolle.» Nur: Wirklich trennen könne man das nicht, und in die Satzung der neuen Gesellschaft habe es diese Aufgabenbeschränkung auch nicht geschafft, sagt Sachse. Aber die Max- Planck-Gesellschaft beruft sich seither umso nachdrücklicher auf ihre Autonomie. «Das ist ihr ‹Nie wieder›.» Nie wieder solle sich die Politik in ihre wissenschaftlichen Agenden einmischen.
Das galt ab Mitte der 1970er-Jahre auch umgekehrt: Die Institution wollte fortan nicht mehr, dass sich ihre Forschenden in die Politik einmischten. Machten sich manche dennoch für Abrüstung, Atomwaffenkontrolle oder eine neue Ostpolitik stark, dann «wurden sie im eigenen Haus ignoriert, manche sogar informell abgemahnt», sagt Sachse. «Sie sollten öffentlich höchstens als Privatpersonen auftreten, auf gar keinen Fall als Wissenschaftler der Max-Planck-Gesellschaft.»
Aktiv friedensfördernd hat die Institution laut Historikerin Sachse nie agiert. «Forschung stand immer an erster Stelle. Sie liess sich zwar diplomatisch einspannen. Aber nur, wenn die aussenpolitischen Vorgaben mit den eigenen wissenschaftlichen Interessen kompatibel waren.» So habe die Gesellschaft beispielsweise, ebenfalls Mitte der 1970er-Jahre, stellvertretend für das westdeutsche Wissenschaftssystem die Beziehungen zu China gemanagt. Aber nur, weil sie sich auf diese Weise maximale Autonomie in ihrer Zusammenarbeit sichern konnte. «Da hat sich das Aussenamt immer wieder beschwert, weil die Max- Planck-Gesellschaft mache, was sie wolle», sagt Sachse.
Vertrauen durch persönlichen Austausch
Manchmal geht es nicht anders und internationale Wissenschaftskooperationen müssen beendet werden. Das passierte am 28. Februar 2022, vier Tage nach Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. Da tagte der Präsidialausschuss der Volkswagenstiftung, der grössten privaten Wissenschaftsförderin Deutschlands, und beschloss das Aus aller gemeinsamen Projekte mit russischen Forschungseinrichtungen.
Das betraf auch die «Trilateralen Partnerschaften» zwischen Russland, der Ukraine und Deutschland. Ein vergleichsweise kleines Programm, das zuvor aber beispielhaft zeigte, dass Wissenschaftsförderung friedensfördernd sein kann: «Wir haben diese Konstellation nach der russischen Annexion der Krim gewählt, um einen Beitrag zur Annäherung und Verständigung der Länder zu leisten», erklärt Henrike Hartmann, stellvertretende Generalsekretärin der Stiftung. Viele Jahre habe man die Kooperation erhalten können – aber mit Kriegsbeginn sei das nicht mehr möglich gewesen.
Dabei löste das Programm laut Hartmann ein, was sich die Volkswagenstiftung erhofft hatte: hohe wissenschaftliche Qualität und den persönlichen Austausch zwischen den Forschenden. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr ein Symposium 2019 in Dresden, zu dem viele der Beteiligten angereist waren. Treffen mussten sich die russischen und ukrainischen Forschenden stets auf neutralem Boden. «Da habe ich gesehen, was für eine lebendige und vertrauensvolle Community durch unsere Förderung entstanden ist.»
Insgesamt förderte die Volkswagenstiftung mit 15,4 Millionen Euro 39 solche Projekte. Aktuell laufen noch neun bilateral zwischen Deutschland und der Ukraine. Sie enden spätestens kommendes Jahr – und damit auch die trilateralen Partnerschaften. An ihre Stelle werden Initiativen treten, um Forschende und Forschungseinrichtungen in der Ukraine zu unterstützen. «Wir wollen mit unserer Förderung vor allem wissenschaftliche Qualität steigern. Sekundär mag das ein kleiner Beitrag für die internationale Zusammenarbeit und den Frieden sein», sagt Hartmann. «Aber wir müssen realistisch sein: Tritt ein Konflikt in die heisse Phase ein, verlieren Wissenschaftskooperationen ihre friedensfördernde Bedeutung. » Das zeigt sich aktuell auch am Cern, am Paradebeispiel für Wissenschaftsdiplomatie: Ende November 2024 hat es – wie bereits 2022 angekündigt – fast alle Beziehungen zu Russland gekappt.