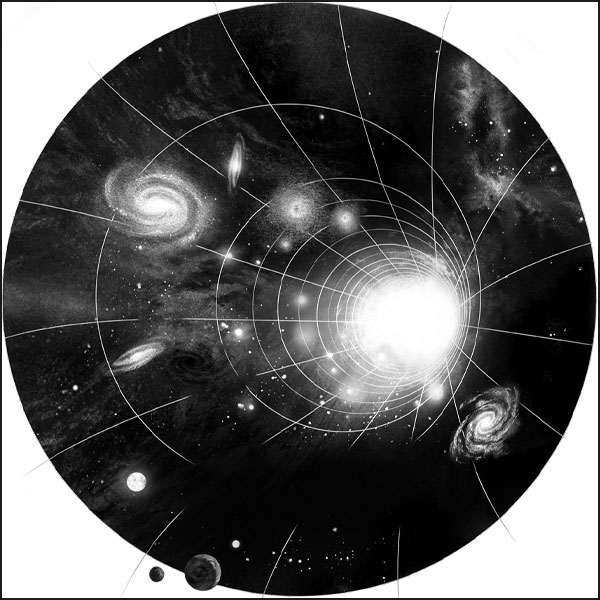Forschungsgruppen
Je grösser das Team, desto schlechter für die Karriere
Oft arbeiten junge Forschende in grossen Teams. Das hilft der Sichtbarkeit ihrer Leistungen nicht. Und fördert auch nicht ihre Chance auf eine akademische Laufbahn.

Wenn viele Leute in einem Forschungsteam arbeiten, kann es für die Gruppenleitungen schwierig werden, zu verstehen, wer davon selbständig forschen kann. | Foto: Christian Beutler / Keystone
Teamarbeit ist das Mass aller Dinge in der modernen Forschung. Sie punktet in Diversität und Interdisziplinarität. Auch deswegen verlangen manche Forschende, dass Preise und Auszeichnungen an Teams und nicht an Individuen gehen. Schon seit Jahrzehnten werden Forschungsgruppen tendenziell immer grösser. Als Indikator dafür dient die Anzahl Autorinnen pro Publikation. Diese ist gemäss Nature von 2,1 Personen im Jahr 1970 auf 4,1 Personen im Jahr 2004 gestiegen. Sie dürfte heute noch höher liegen.
Die Ökonomin Donna Ginther von der Universität Kansas hat als Co- Autorin eine Untersuchung dazu publiziert, wie sich die Teamgrössen auf die Karrieren von Nachwuchsforschenden auswirken. Sie analysierte Daten aus einer 40 Jahre dauernden Erhebung der US-amerikanischen National Science Foundation, welche die Laufbahn Doktorierender verfolgt. Die Ergebnisse zeigen: Mit jedem zusätzlichen Autor pro Paper sinkt die Wahrscheinlichkeit, eine Tenure- Track-Position zu bekommen, um 25 Prozent, auf staatliche Fördergelder um 11 Prozent.
Ginther meint auf Statnews. com: «Es liegt wohl daran, dass man nicht recht weiss, wer was macht.» In kleinen Teams sei die Arbeitsteilung ziemlich gut definiert. Aber wenn es grösser werde und man sich die individuellen Angaben darüber, wer was beigetragen hat, «nicht genau ansieht und nicht weiss, ob man diesen auch trauen kann», sei es schwierig, den Überblick zu behalten. «Es braucht also mehr Informationen, um zu erkennen, ob diese Leute die Fähigkeiten haben, unabhängig zu forschen.»
Dies führe dazu, dass eher erfahrene Forschende Gelder und Anstellungen bekämen. Ginther rät deswegen Personen, die erst am Anfang ihrer Karriere stehen, bewusst zu wählen, in welchen Teams sie forschen wollen: «Bei einer grossen, berühmten Wissenschaftlerin, die viele Leute im Labor hat, bekommt man vielleicht keine Aufmerksamkeit. In einem kleineren Labor hat man vielleicht mehr Möglichkeiten.»