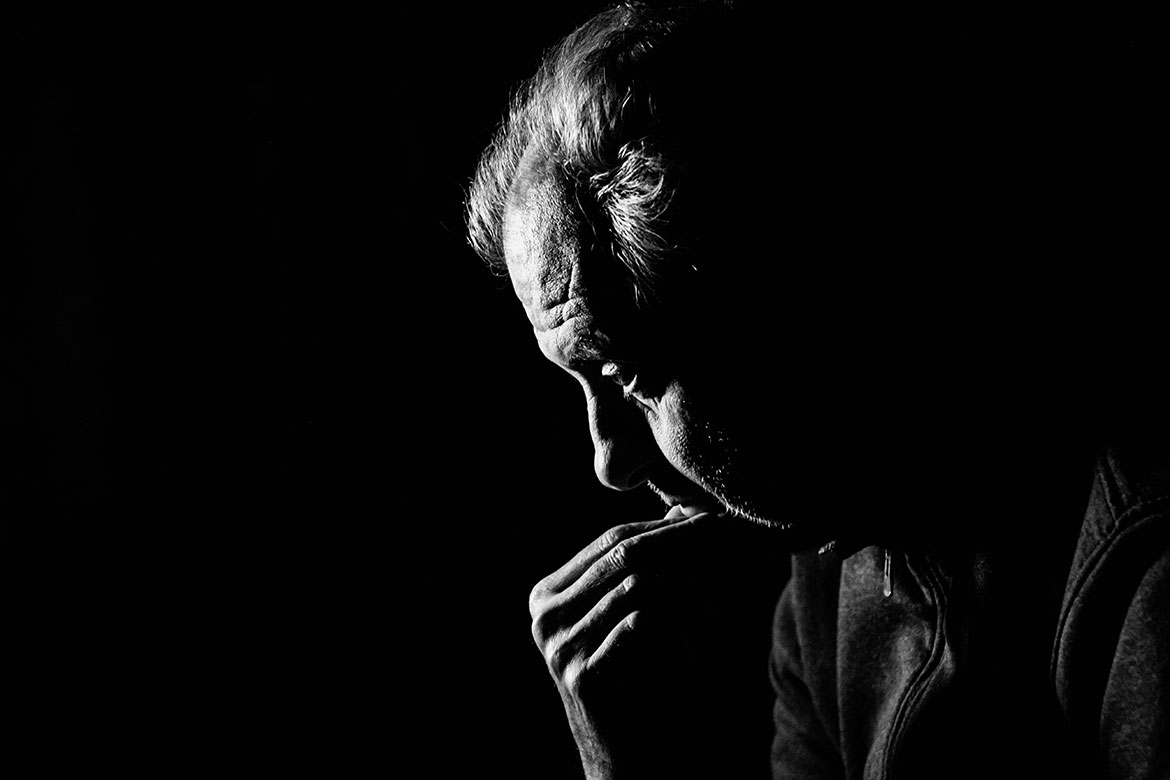Fokus: Forschung für den Frieden
Zusammen forschen ja, über den Krieg reden nein
2017 wurde in Jordanien der Teilchenbeschleuniger Sesame in Betrieb genommen. Ziel war es, «durch internationale Zusammenarbeit zu einer Kultur des Friedens beizutragen». Zwei Forschende sprechen über ihre Erfahrungen.
Die von der Unesco unterstützte und nach Vorbild des Cern konzipierte Synchrotron-Anlage Sesame in Jordanien hat das Ziel, der Forschung im Nahen Osten Impulse zu verleihen. Gleichzeitig sollte sie Toleranz und Frieden fördern – insbesondere zwischen ihren Mitgliedsstaaten Ägypten, Iran, Israel, Jordanien, Pakistan, Palästina, Türkei und Zypern.
Mit der Eskalation im Nahen Osten seit dem 7. Oktober 2023 hat sich die Stimmung verändert. Alle neun Forschenden aus Palästina, Iran und Ägypten, die wir für diesen Artikel kontaktiert haben, wollten sich nicht öffentlich äussern. Einige sprachen vom Unbehagen, «über Frieden zu reden, während Bomben fallen», oder waren resigniert: «Die Politik hört nicht auf die Forschenden. Sie macht, was sie will.» Ein Forscher aus Israel und einer aus der Türkei waren schliesslich bereit, uns über Ihre Erfahrung am Sesame zu erzählen.

«Ich war dreimal am Sesame. Meine vierte Reise war für den 8. Oktober 2023 geplant, den Tag nach den Anschlägen der Hamas … Ich habe natürlich abgesagt. Aktuell kann ich meine Studierenden nicht davon überzeugen, hinzugehen – ich würde sogar selber zögern. Wir wären wohl nicht völlig sicher. Aber sobald sich die Lage bessert, werde ich zurückkehren.
Sesame ist ein schönes Projekt, und es zeugt von regionaler Zusammenarbeit. Für den Frieden ist es jedoch nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Es braucht mehr Personal und mehr Beamlines – die Experimentierstationen um den ringförmigen Elektronenbeschleuniger, bei denen die Strahlen für Kristallografie und Spektroskopie eintreffen. Dies würde die Nachfrage und damit die Zusammenarbeit zwischen Forschenden fördern. Der Austausch findet zwischen Personen statt, die den Beschleuniger besuchen und vor Ort übernachten, weniger mit dem Personal, das meist in Amman wohnt und um 16 Uhr mit dem Bus zurückfährt.
Ich hatte nette Begegnungen am Sesame, auch mit Menschen aus Ländern, die politische Spannungen mit Israel haben. Ich arbeite gerne mit dem Beamline-Spezialisten aus Ägypten zusammen. Ich teilte mir auch ein Gästehaus mit einem iranischen Forscher.
Solche Kooperationen gibt es allerdings nicht nur bei Sesame. Ich reise regelmässig zu ähnlichen Einrichtungen in Frankreich, Deutschland oder Italien, wo ich Menschen aus der ganzen Welt treffe. Seit Jahren arbeite ich mit iranischen Forschenden zusammen, vor allem innerhalb meiner Forschungsgruppen. Dabei spielt die Nationalität der Menschen absolut keine Rolle. Wir sind Forschende und sprechen die gleiche Sprache: Wissenschaft.»

«Unsere Forschung profitiert von Sesame. Dank der zusätzlichen Experimente sind unsere Ergebnisse solider und wir können prominenter veröffentlichen. Ich habe in Soleil, einer ähnlichen Einrichtung in Frankreich, gearbeitet, aber der Zugang dazu ist sehr kompetitiv. Die Technologie von Sesame ist zwar weniger fortgeschritten, aber leichter zugänglich. Sogar ein deutscher Forscher sagte mal, dass seine Anträge dort schneller genehmigt werden als zu Hause.
Ich habe Sesame 2023 zweimal und 2024 einmal besucht. Normalerweise bleibe ich ein paar Tage im Gästehaus. Einmal konnte ich einen Tag lang Sehenswürdigkeiten ansehen. Ich traf einen Vertreter der schwedischen Botschaft in Jordanien und freute mich über das Interesse der Politik an der Forschung. Als Wissenschaftler denke ich nie über die Nationalität der Menschen nach, mit denen ich zusammenarbeite. Vielleicht haben gewisse Gutachtende Vorurteile gegenüber bestimmten Ländern oder Religionen, aber das wäre völlig inakzeptabel.
Ich arbeite hervorragend mit einer führenden bulgarischen Wissenschaftlerin zusammen, und die alten Spannungen zwischen unseren Regierungen sind für mich absolut irrelevant. Das Gleiche gilt für Zypern: Politikerinnen mögen zeitweise die Spannungen betonen, insbesondere vor Wahlen, aber das hindert türkische Forschende nicht daran, in Griechenland zu arbeiten und umgekehrt.
Ich lerne viel aus der Zusammenarbeit mit Forschenden aus Europa oder den USA. Bei einem Projekt mit Leuten aus Pakistan ist es ausgeglichener, oder ich bin vielleicht sogar derjenige, der etwas mehr einbringt. Es ist gut, Erfahrungen auszutauschen. Da die türkische Lira viel Wert verloren hat, sind Auslandreisen für uns jetzt sehr teuer. Glücklicherweise übernimmt unsere Regierung einige Kosten. Das Hauptproblem für die Wissenschaft in der Region ist nicht die angespannte politische Lage, sondern die Finanzierung.»