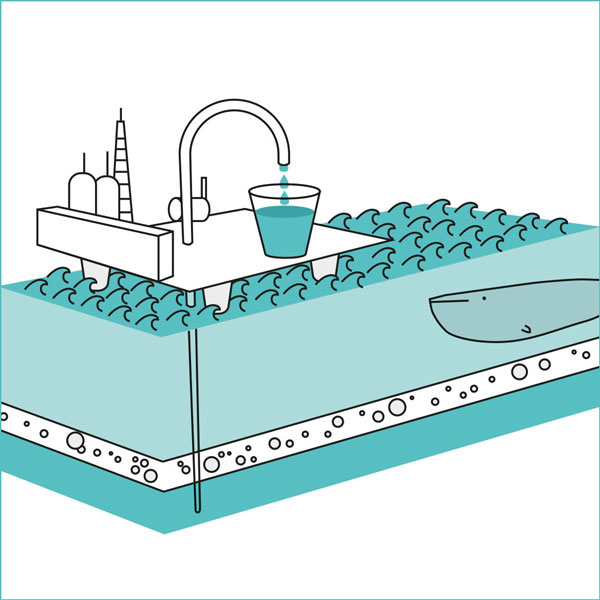EVOLUTION
Der Mensch, dieser komische Affe
Je mehr die Wissenschaft zu verstehen versucht, was den Menschen von anderen Affen unterscheidet, desto mehr verwischen sich die Grenzen. Ein frischer Blick auf Schimpansen, Bonobos und Gorillas.

Wie ähnlich Gorillas uns Menschen doch sind! Und doch hat das Leben in der Savanne uns Menschen massgeblich verändert. | Foto: Shutterstock
Eine Abfolge schwarzer Silhouetten mit einem Affen auf allen vieren, der sich schliesslich zu einem Homo sapiens auf zwei Beinen aufrichtet: Unweigerlich beschwört das Stichwort Evolution diese populäre Darstellung herauf. Sie erinnert an unsere Verwandtschaft mit den Affen, erweckt aber fälschlicherweise den Eindruck, dass wir an der Spitze der Evolution thronen und Gorillas, Bonobos und andere Schimpansen unsere Vorfahren sind.
Alles Cousins und Cousinnen
In Wirklichkeit haben auch sie sich aus unseren gemeinsamen Vorfahren entwickelt. «Wir sollten nicht vergessen, dass wir eine Menschenaffenart sind, gleichzeitig aber keine falschen Schlüsse ziehen», meint Thibaud Gruber, Professor für Psychologie an der Universität Genf und Co-Leiter des Bugoma Primate Conservation Project in Uganda. Zwar sind wir genetisch näher mit Schimpansen verwandt als diese mit Gorillas, für die Primatologie ist genetische Verwandtschaft jedoch nicht die entscheidende Frage. «Wir sind alle Cousins, mit vielen gemeinsamen Merkmalen, aber auch Besonderheiten, die sich in jeder Art entwickelt haben», betont er.
Zahlreiche Studien belegen, dass einige Menschenaffen Eigenschaften besitzen, die lange Zeit als einzigartig für die Spezies Mensch galten: Werkzeuggebrauch, Persönlichkeit, Empathie, soziale Strukturen und gruppenabhängige Kultur. Gemäss Gruber beschreibt der von Evolutionsbiologen gewählte Begriff der Kultur dabei Verhaltensweisen, die nicht angeboren oder instinktiv sind und durch Lernen innerhalb der Gruppe weitergegeben werden. Dazu gehört zum Beispiel das Waschen der Nahrung oder das Benutzen eines Stocks, um Honig aus einem Baumstamm zu kratzen. Damit sich Unterschiede zwischen Clans erkennen lassen, sei es so wichtig, die Primaten auch in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten.
Davon ist auch Kathelijne Koops, Professorin für Anthropologie und Expertin für Verhaltensevolution an der Universität Zürich, überzeugt. Sie reist für die Feldforschung regelmässig nach Afrika und untersucht das Lernen bei Menschenaffen, Menschen eingeschlossen. Sie beschäftigt sich insbesondere mit dem Werkzeuggebrauch, der bei Schimpansen verbreitet ist, bei wilden Gorillas und Bonobos aber weitgehend fehlt. «Das ökologische und soziale Umfeld spielt bei diesen Verhaltensunterschieden eine Rolle», erklärt die Forscherin. «Es zeigt sich zum Beispiel, dass Bonobos in Gefangenschaft durchaus lernen können, Werkzeuge zu benutzen. Weshalb sie dies in der Natur nicht tun, ist ein Rätsel.»
Trotz der vielen Gemeinsamkeiten gibt es Unterschiede, die uns von unseren nächsten Verwandten trennen: «Im Laufe der Evolution hat sich bei den Menschen eine spezielle Dynamik entwickelt, sie haben ihren eigenen Weg eingeschlagen und neue Dimensionen erschlossen», sagt Gruber. «Eine relativ neue Erfindung, die Sprache, hatte einen unglaublichen Einfluss auf unsere Kognition.» Damit eröffnete sich uns eine neue Fähigkeit zur Konzeptualisierung der Welt. Laut Koops hat der Erwerb einer komplexen Kommunikation auch Auswirkungen über die Gehirnentwicklung hinaus, indem Wissen weitergegeben werden kann. «Lernen durch Beobachtung reicht nicht immer aus. Komplexe Technologien erfordern einen aktiven Unterricht», erläutert sie. «Die Sprache ermöglicht diesen Schritt.»
Vom Kuschelhormon zur Kooperation
Unsere Fähigkeit, komplex zu kommunizieren, ist auch für Redouan Bshary, Ökoethologe an der Universität Neuenburg, ein entscheidendes Element. Denn diese hat noch weitere Auswirkungen. «Aussergewöhnlich ist auch unsere Bereitschaft, selbst Fremden zu helfen. Durch Sprache und geteilte Intentionalität können wir Möglichkeiten der Zusammenarbeit erschliessen.» Die Hyperkooperativität der menschlichen Spezies ist somit vor allem mit zwei Faktoren zu erklären: Sprache und dass wir uns ins Gegenüber versetzen und gemeinsame Gedanken erkennen können.
Bshary ist eigentlich in erster Linie Fischspezialist, hat jedoch auch mit kleinen Affen gearbeitet. Er untersucht die Interaktionen zwischen Arten und den Einfluss der Umwelt auf ihr Verhalten und ihre Entwicklung: «Die natürliche Selektion interessiert sich nur für Mechanismen, die gut für den Erfolg des Individuums und seiner Gene sind. Beim Menschen führte Zusammenarbeit zum Erfolg.» Die für dieses Verhalten notwendigen psychologischen und hormonellen Mechanismen waren für das Überleben und die Fortpflanzung günstig und damit ein Selektionsvorteil.
Als Beispiel nennt der Forscher das sogenannte Bindungshormon Oxytocin, das für die Eltern-Kind-Bindung wichtig ist. «Die Menschen haben diesen Mechanismus für das Knüpfen von Beziehungen zu Partnern, Freunden und anderen Gruppenmitgliedern sozusagen zweckentfremdet.» Und der Begriff der Gruppe ist bei den Menschen weit gefasst, denn er kann vom Fussballverein über eine Religion bis hin zu einer Nation reichen – soziale Strukturen, in denen unser Verhalten auf biologischen Altruismus zurückzuführen ist. Aber wer anderen hilft, profitiert auch, direkt oder indirekt. «Gerechtigkeitssinn, Moral, Empathie … Unser Bestreben, nett zu sein, ist auch physiologisch bedingt. Es ist da, um unsere Kooperationsbereitschaft zu erhöhen, im Interesse des Einzelnen und seiner Gene.»
Ein grösseres Gehirn, höher entwickelte Kognition, Sprache, geteilte Intentionalität und Kooperativität sind alles Stufen der schwindelerregenden Entwicklungsspirale des Homo sapiens. Diese Merkmale gehen mit dem Einsatz immer komplexerer Werkzeuge und Technologien einher. «Man muss das Rad nicht in jeder Generation neu erfinden. Es braucht nur ein paar Genies und die Fähigkeit zur Kooperation, um die ganze Gruppe voranzubringen», so Verhaltensökologe Bshary.
Verzerrender Fokus auf moralisch Wünschenswertes
Dass Schimpansen, Bonobos und Gorillas nicht denselben Weg eingeschlagen haben, lässt sich damit erklären, dass Genetik in einen Kontext eingebettet ist. «Die Ökologie hat uns von den anderen Menschenaffen getrennt.» Der Selektionsdruck kann sich je nach Umgebung drastisch ändern, beispielsweise bei einem Wechsel vom Regenwald in die Savanne. Dies kann immense Unterschiede in der Entwicklung innerhalb einer relativ kurzen Zeit zur Folge haben. «Wir hatten etwa sieben Millionen Jahre Zeit, um uns von den Schimpansen und Bonobos zu trennen. Aber unser Gehirn ist erst vor etwa 300 000 Jahren explodiert.» Dass der Mensch bei seiner evolutionären Entwicklung eine völlig andere Richtung einschlug, verdankte er also einer Verkettung von Umständen, einem wohldosierten Cocktail aus genetischem Gepäck und Umwelteinflüssen.
Es gibt keine eindeutige Antwort auf die Frage, ob die Sprache und die ausgeprägte Kooperationsbereitschaft der Menschen direkt dem Überleben und der Fortpflanzung förderlich sind oder ob sie eher ein Nebenprodukt anderer von der Evolution selektionierter Merkmale sind. «Wir müssen uns eingestehen, dass wir nicht viel darüber wissen, was passiert ist, da sich kognitive Fähigkeiten nicht in Fossilien nachweisen lassen», stellt Rebekka Hufendiek fest, die sich mit der menschlichen Natur und der Philosophie des Geistes befasst.
Die Professorin für philosophische Anthropologie der Universität Ulm sieht Fallstricke bei der zu beharrlichen Suche danach, was uns von anderen Tieren unterscheidet: «Bei der Beschreibung dessen, was uns wirklich zu Menschen macht, konzentrieren sich Forschende oft auf Eigenschaften, die sie für faszinierend oder moralisch wünschenswert halten.» Für eine objektive, umfassende Sicht sind aber alle Faktoren zu betrachten, und es sollte nicht nur nach einem entscheidenden Unterscheidungsmerkmal gesucht werden.
Diesen Standpunkt teilen alle vier befragten Forschenden. Einig sind sie sich auch darin, dass eher Ansichten als Fakten dominieren, wenn darüber geurteilt wird, welche Eigenheiten den Menschen wirklich ausmachen und wie sie sich entwickelt haben. Die gemeinsame Haltung auf den Punkt bringt der Psychologe Thibaud Gruber: «Niemand kann bestreiten, dass Menschen etwas Besonderes sind. Immerhin sind wir wahrscheinlich die einzigen Wesen, die sich Gedanken über unseren Platz im Universum machen.» Es wäre demnach der berühmten Darstellung der Evolution fast zu verzeihen, dass sie uns glauben liess, wir seien etwas Besonderes.