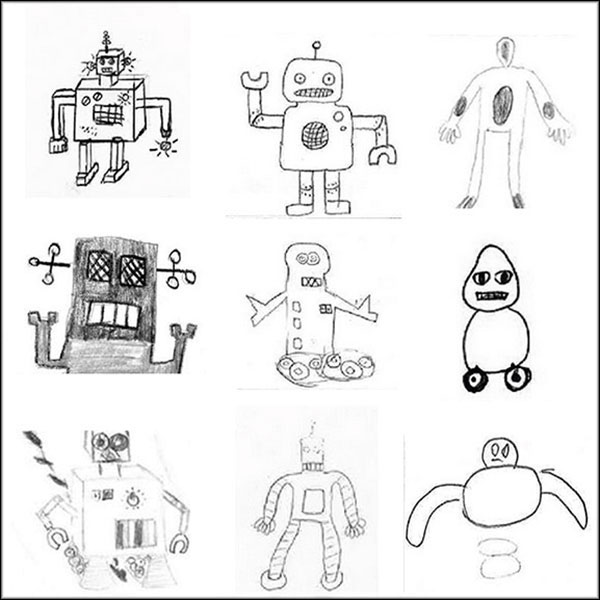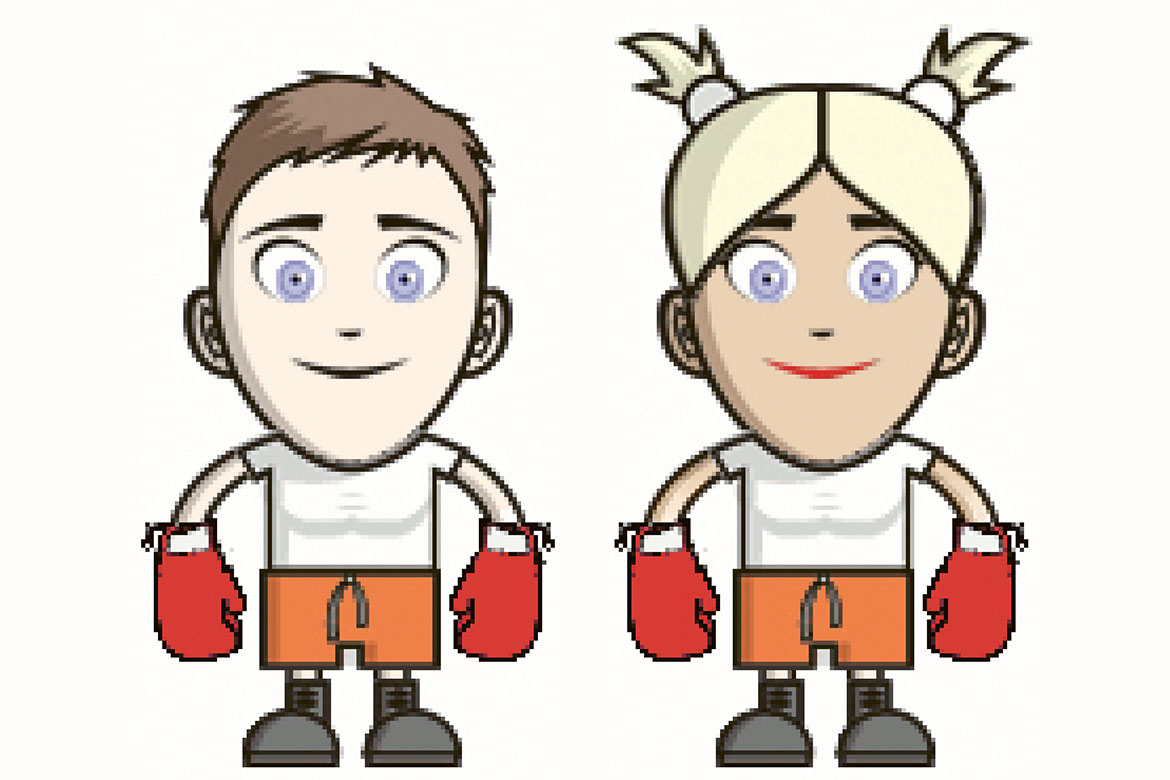Kinder und Schwangere, die Vergessenen der Medizinforschung
Niemand will an Schwangeren und Kindern Medikamente testen, obwohl auch sie sichere und wirksame Behandlungen brauchen. Schweizer Forschende suchen nach Lösungen.

Valérie Chételat
Medikamente sind während der Schwangerschaft tabu. So lautet das Credo. Die Realität ist eine andere: Laut einer internationalen Studie, die 2014 im British Medical Journal erschien, nehmen 80 Prozent aller Frauen während der Schwangerschaft Medikamente. Umso wichtiger ist für das medizinische Personal das Wissen, welche Substanzen für das ungeborene Kind gefährlich sein könnten und welche nicht. Schwangere Frauen sind von medizinischen Studien aber oft ausgeschlossen, weil niemand willentlich die Gesundheit des Fötus riskieren will.
Obwohl niemand bestreitet, dass sich Frauen und Männer grundsätzlich unterscheiden, testen Medizinforschende neue Medikamente und Therapien noch immer hauptsächlich an Männern. Man nimmt einfach an, dass sie für Frauen gleich wirken. Das tun sie aber längst nicht immer.
Der Stoffwechsel von Männern und Frauen verarbeitet Medikamente manchmal anders. In der weiblichen Leber befinden sich teilweise andere Enzyme, die dafür sorgen, dass Medikamente wirken oder eben nicht. Zudem verteilen sich die Substanzen anders im Körper. Frauen sind meist kleiner und haben einen höheren Anteil an Fettgewebe. Gewisse Medikamente sammeln sich dort an, was wiederum deren Wirkung beeinflusst. Die weiblichen Nieren erreichen nur 80 Prozent der Leistung der männlichen Nieren, was beim Ausscheiden der Abbauprodukte eine Rolle spielt. Die Auswirkungen des weiblichen Zyklus sind dabei noch nicht berücksichtigt.
Reaktion auf Contergan-Skandal
Mindestens so schwierig ist die Situation bei Kindern, die in der medizinischen Forschung ebenfalls wenig berücksichtigt werden. Nur wenige Medikamente entwickeln die Forschenden spezifisch für sie. Doch Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, bei denen man einfach die Dosis dem Gewicht entsprechend reduzieren kann. Zudem ist die Bandbreite in der Kindermedizin riesengross: Neugeborene lassen sich nicht mit Schulkindern vergleichen, Pubertierende nicht mit Kleinkindern.
In der Schweiz gibt es verschiedene Initiativen, die diesen unhaltbaren Zustand ändern möchten. Alice Panchaud, Pharmakologin am Universitätsspital Lausanne (CHUV), erforscht Methoden, um für Schwangere unbedenkliche Medikamente zu finden. Bis in die 1960er Jahre gab es wenig Bewusstsein für dieses Thema. Dann wurde der Contergan-Skandal in Deutschland aufgedeckt: Kinder mit missgebildeten Armen und Beinen kamen zur Welt, nachdem ihre Mütter während der Schwangerschaft das Beruhigungsmittel Contergan eingenommen hatten, das auch gegen die morgendliche Übelkeit wirkte. Seither versucht man alles, um Schwangere möglichst keinen Medikamenten auszusetzen. «Realistisch ist das leider nicht», sagt Panchaud, die im Moment einen zweijährigen Forschungsaufenthalt an der Harvard School of Public Health verbringt. Es gäbe Krankheiten, die man während der Schwangerschaft behandeln müsse, weil sie für das Ungeborene gefährlicher wären als allfällige Medikamente.
Daten der Einzelfälle sammeln
Auch wenn Schwangere nicht an klinischen Studien teilnehmen, gibt es zwei Arten, trotzdem zu brauchbaren Daten zu kommen: Einerseits nehmen immer wieder Frauen Medikamente ein, ohne etwas von einer Schwangerschaft zu ahnen. Andererseits sind gewisse Frauen aus medizinschen Gründen gezwungen, Substanzen einzunehmen. «Die Daten dieser beiden Gruppen müssen wir unbedingt sammeln und analysieren», sagt Panchaud. So könne man langsam eine Datenbank aufbauen mit Medikamenten, die für Schwangere unbedenklich sind.
In den USA und in Nordeuropa kommt der Aufbau derartiger Datenbanken gut voran. In der Schweiz gibt es in diese Richtung noch zu wenig Anstrengungen, die Situation ist zudem durch die viel bescheidenere Datenmenge erschwert. Nicht nur die Frage, ob ein Mittel unbedenklich ist, muss bei schwangeren Frauen geklärt werden. Auch die Dosis weicht in der Schwangerschaft häufig ab. Frauen nehmen an Gewicht zu und lagern mehr Wasser im Körper ein. Meist müssen die Ärzte die richtige Dosis deshalb erhöhen. Auch diese müssten sie für jeden Fall anhand von Daten bestimmen können. Am CHUV bauen die Zuständigen aus diesem Grund nun eine Biobank mit Blutproben von Schwangeren auf, die Medikamente bekommen.
Kinder haben anderen Krebs
Auch bei Kindern gibt es Anstrengungen, die Situation zu verbessern. Das Forschungsnetz Swiss Pednet, ein Zusammenschluss der Kinderspitäler, setzt sich dafür ein, dass mehr Medikamente und Therapien spezifisch für Kinder entwickelt werden. Das Dilemma ist ein ähnliches wie bei den schwangeren Frauen. Niemand möchte Medikamente an gesunden Kinder testen. Gleichzeitig gibt es viele Situationen, in denen Kinder Medizin brauchen. «Wir wollen auch die kranken Kinder keinen Experimenten aussetzen», sagt David Nadal, Leiter der Infektiologie am Kinderspital Zürich und Mitinitiant von Swiss Pednet. Deshalb brauche es in der Pädiatrie eine professionelle Forschungsstruktur und die entsprechenden Finanzen, um Daten zu sammeln und zu analysieren. «Das Bewusstsein in der Gesellschaft muss steigen, wie wichtig medizinische Studien allgemein und besonders für Kinder sind», sagt Nadal. Heute würden bereits über 80 Prozent der krebskranken Kinder in den Spitälern im Rahmen von Studien behandelt. Besonders bei Krebserkrankungen ist der Bedarf für neue Substanzen gross, die spezifisch den Kindern helfen. Sie erkranken meist an anderen Krebsarten als Erwachsene.
Durch die Initiative verschiedener Forscherinnen hat sich in den letzten Jahren auch gezeigt, dass bei Herzerkrankungen ein klarer Geschlechtsunterschied besteht. «Frauen sterben doppelt so häufig an Herzinfarkten wie Männer», sagt die Kardiologin Catherine Gebhard vom Universitätsspital Zürich. Sie haben zudem nach einem Herzinfarkt schlechtere Überlebenschancen. Trotzdem sind nur 24 Prozent der Testpersonen in Herzstudien weiblich, ältere Frauen sind kaum vertreten. Obwohl inzwischen klar ist, dass sich männliche und weibliche Herzen im Alter anders entwickeln.
«Wir wissen noch viel zu wenig darüber, warum Frauen häufiger an einem Herzinfarkt sterben als Männer», sagt Gebhard. Das Problem fange schon auf der untersten Stufe an. Fast alle Labortiere für die Versuche, die vor den klinischen Studien am Menschen stattfinden, sind männlich. Die Annahme dabei sei: Die Resultate gelten auch für weibliche Tiere. Gebhard leitet nun ein Forschungsprojekt, bei dem sie herausfinden möchte, warum Frauenherzen anders altern. In naher Zukunft sollen herzkranke Frauen genauso wie Schwangere und Kinder gezielter medizinische Hilfe erhalten.
Alexandra Bröhm ist Wissenschaftsjournalistin beim Tages-Anzeiger und bei der Sonntagszeitung.